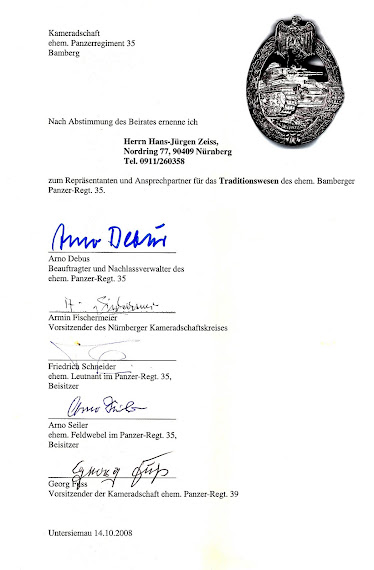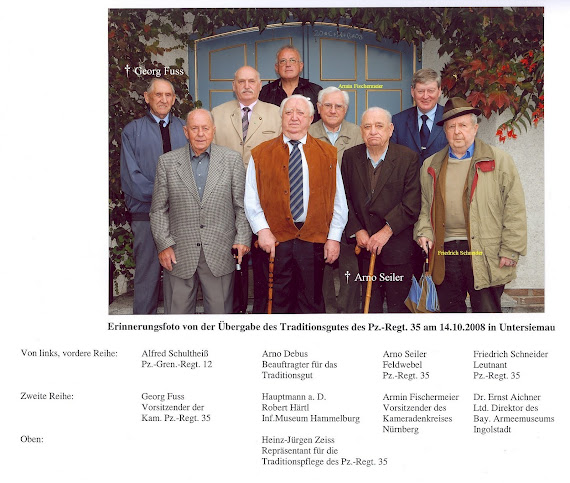Hans Oppel
 |
| geboren:30.1.27 - gestorben:15.11.2009 |
Der Panzerkameradschaft Nürnberg und Otto Eidloth aus Bamberg lag es sehr am Herzen, das ehrenvolle Andenken an Hans Oppel zu bewahren. Bevor die Arbeiten an diesem Blog ein Ende finden, will ich meine letzten Versprechen den Veteranen gegenüber erfüllen. Seine menschliche Art macht Hans Oppel unvergesslich. Mit seinem Buch "Ein Leben unter dem Stern" hat er ein eindrucksvolles Zeugnis seines Lebens und Schaffens hinterlassen. Seine Schilderungen zur Militärzeit sind besonders für unsere Jugend wichtig, als Mahnung für die Zukunft und den Frieden. Wir erlauben uns Fachbegriffe aus unserer Heimat zu erklären, da nun der Text in alle Sprachen übersetzt werden kann. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Familie Oppel.
Wie mir seine Tochter sagte, war er in der Stunde des eigenen Todes bei dem jungen, ungefähr gleichaltrigen Burschen, den er im Exekutionskommando erschießen musste und sprach über ihn. Hier führte der Tod wieder die ansonsten so unterschiedlichen Wege der Beiden beeindruckend zusammen.
Unser Schullehrer German Haas, ging uns als Fähnleinführer (Hitlerjugend) voraus und wusste uns mit Zeltlagern und Geländespielen zu begeistern, auch eine politische Schulung im Sinne des Führers.
Der scheinbare wirtschaftliche Aufschwung bekräftigte die Erwachsenen.
Die Expansion des Reiches, Österreich — Tschechei, ein Großdeutschland , - der Beginn eines Wahnsinns? Was wussten wir Kinder von der Wirklichkeit. Wir wurden gedrillt. Führer befehle — wir folgen dir.
Während es im Naziregime aufwärts ging, war es im Geschäft meines Vaters mit dem Aufschwung vorbei; besonders ab Kriegsausbruch am 1. September 1939. Zwar ging das Fuhrgeschäft weiter, jedoch musste nun vom „PS" auf den „Hafermotor" (Pferd) umgestellt werden. Das hieß, mein Vater musste sich wieder Pferde beschaffen.
Unser 1. Pferde Kauf bleibt mir in ewiger Erinnerung: An einem Sonntag fuhren wir per Fahrrad, mein Vater, Bruder Josef und ich nach Gerolfingen am Hesselberg, um ein Pferd, das zum Verkauf stand, anzuschauen. Vater und Verkäufer wurden sich einig. Ich sollte nun das Pferd am nächsten Tag abholen.
In Vorfreude auf einen herrlichen Tag und einen schönen Heimritt, fuhr ich schon in aller Frühe mit dem Zug nach dorthin. Freudestrahlend nahm ich das Pferd am Zügel und führte es vom Hof
Hinter dem Ort stellte ich das Pferd in einen Graben, um es zu besteigen und auf ihm heim zu reiten. Wie ein bockiger Esel aber blieb es stehen und machte trotz vieler guter Zureden keinen Schritt.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen gab ich auf und führte das Pferd durch viele Ortschaften in Richtung Ansbach. Es wurde schon Nacht als ich Hohenberg erreichte und mir Vater und Bruder Josef, die sich um mich sorgten, entgegen kamen. Ich war mit meinen 14 Jahren am Ende meiner Kräfte.
Die Schulzeit ging zu Ende, das Berufsleben stand vor der Tür.
Wenn andere Buben als Berufsziel zum Beispiel vom Lokführer träumten, war mein Traumberuf schon immer der Schornsteinfeger. In ihm sah ich immer den verrußten und geschwärzten Menschen, der sich nie zu waschen brauchte — denn waschen und Wasser war für mich ein Albtraum. Wasser in den Ohren verursachten in mir die größten Schmerzen und so umging ich, wenn möglich, diese Anwendung.
Als mir meine Eltern erklärten, dass sich gerade der Schornsteinfeger sehr viel und ausgiebig waschen muss, war dieses Berufsziel in mir schnell verflogen.
Nun bewarb ich mich als Jungpostbote bei der Post. Bei der verlangten Aufnahmeprüfung mit vielen jungen Menschen, den Mitbewerbern, die körperlich viel weiter entwickelt waren als ich, hatte ich ein beklemmendes Gefühl und gab mir keine Chance.
Wie es sich später herausstellte, waren es meine rechnerischen Fähigkeiten, die mich mit wenigen diese Aufnahmeprüfung bestehen ließ.
Ich danke Armin Fischermeier, Frau Oppel und Lutz Auerswald für die große Hilfe bei der Realisierung meiner Aufgaben! - Am heutigen Tag, den 13. April hätte unser Verwandter und Onkel, Hauptmann Hans G. Müller Kp. Chef 1. Kp. Pz.Rgt.35 seinen 102. Geburtstag April 2019. Leider ist er am 14.November 1943 gefallen.
Wie mir seine Tochter sagte, war er in der Stunde des eigenen Todes bei dem jungen, ungefähr gleichaltrigen Burschen, den er im Exekutionskommando erschießen musste und sprach über ihn. Hier führte der Tod wieder die ansonsten so unterschiedlichen Wege der Beiden beeindruckend zusammen.
Unser Schullehrer German Haas, ging uns als Fähnleinführer (Hitlerjugend) voraus und wusste uns mit Zeltlagern und Geländespielen zu begeistern, auch eine politische Schulung im Sinne des Führers.
Der scheinbare wirtschaftliche Aufschwung bekräftigte die Erwachsenen.
Die Expansion des Reiches, Österreich — Tschechei, ein Großdeutschland , - der Beginn eines Wahnsinns? Was wussten wir Kinder von der Wirklichkeit. Wir wurden gedrillt. Führer befehle — wir folgen dir.
Während es im Naziregime aufwärts ging, war es im Geschäft meines Vaters mit dem Aufschwung vorbei; besonders ab Kriegsausbruch am 1. September 1939. Zwar ging das Fuhrgeschäft weiter, jedoch musste nun vom „PS" auf den „Hafermotor" (Pferd) umgestellt werden. Das hieß, mein Vater musste sich wieder Pferde beschaffen.
Unser 1. Pferde Kauf bleibt mir in ewiger Erinnerung: An einem Sonntag fuhren wir per Fahrrad, mein Vater, Bruder Josef und ich nach Gerolfingen am Hesselberg, um ein Pferd, das zum Verkauf stand, anzuschauen. Vater und Verkäufer wurden sich einig. Ich sollte nun das Pferd am nächsten Tag abholen.
In Vorfreude auf einen herrlichen Tag und einen schönen Heimritt, fuhr ich schon in aller Frühe mit dem Zug nach dorthin. Freudestrahlend nahm ich das Pferd am Zügel und führte es vom Hof
Hinter dem Ort stellte ich das Pferd in einen Graben, um es zu besteigen und auf ihm heim zu reiten. Wie ein bockiger Esel aber blieb es stehen und machte trotz vieler guter Zureden keinen Schritt.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen gab ich auf und führte das Pferd durch viele Ortschaften in Richtung Ansbach. Es wurde schon Nacht als ich Hohenberg erreichte und mir Vater und Bruder Josef, die sich um mich sorgten, entgegen kamen. Ich war mit meinen 14 Jahren am Ende meiner Kräfte.
Die Schulzeit ging zu Ende, das Berufsleben stand vor der Tür.
Wenn andere Buben als Berufsziel zum Beispiel vom Lokführer träumten, war mein Traumberuf schon immer der Schornsteinfeger. In ihm sah ich immer den verrußten und geschwärzten Menschen, der sich nie zu waschen brauchte — denn waschen und Wasser war für mich ein Albtraum. Wasser in den Ohren verursachten in mir die größten Schmerzen und so umging ich, wenn möglich, diese Anwendung.
Als mir meine Eltern erklärten, dass sich gerade der Schornsteinfeger sehr viel und ausgiebig waschen muss, war dieses Berufsziel in mir schnell verflogen.
Nun bewarb ich mich als Jungpostbote bei der Post. Bei der verlangten Aufnahmeprüfung mit vielen jungen Menschen, den Mitbewerbern, die körperlich viel weiter entwickelt waren als ich, hatte ich ein beklemmendes Gefühl und gab mir keine Chance.
Wie es sich später herausstellte, waren es meine rechnerischen Fähigkeiten, die mich mit wenigen diese Aufnahmeprüfung bestehen ließ.
Lehrzeit
Am 1. April 1941 begann ich meine Lehre als Jungpostbote. Dieser Beruf machte mir sofort viel Spaß. Nach einem halben Jahr als Postbote, war ich schon im Schalterdienst tätig und bekam 1 Jahr später die Poststelle am Katterbacher Militärflugplatz. Schon bald hatte ich das beste Verhältnis zu den hier stationierten Fliegern.
Unterdessen, am 12. Oktober 1942, war mein 18- Jähriger Bruder Karl zum Infanterieregiment eingezogen worden, kam dann zur Panzerabwehr und war dann bis Kriegsende als Kradmelder in Norwegen eingesetzt. Im Januar 1944 musste ich zum Arbeitsdienst. Für meine Eltern, besonders für meinen Vater, war dies ein schwerer Schlag. Sie waren immer im Glauben gewesen, dass ich vom Wehrdienst, aufgrund meiner körperlichen Schwäche, verschont würde.
Mein Vater war total gegen das Naziregime eingestellt und konnte so vieles nicht mehr verstehen.
Im 1. Weltkrieg selbst Teilnehmer und hauptsächlich im blutigen Kampfgebiet Verdun eingesetzt, war er mit vielen schrecklichen Erlebnissen prinzipiell gegen jeden Krieg. Was ihn aber ganz besonders und in dieser Zeit bedrückte, war die Verfolgung der Juden. Sie hatten im 1. Weltkrieg als Deutsche an seiner Seite gekämpft, waren nach dem Krieg seine Freunde geworden, hatte einigen viel zu verdanken, den Händlern und auch den Ärzten, die die Familie in der Notzeit auch ohne Honorar behandelten. Sie gab es nicht mehr. Auch ihre christliche Erziehung und ihre tiefe Frömmigkeit sprachen dagegen. Die Enttäuschung meines Vaters ging so weit, dass er mit mir überhaupt nicht mehr sprach. Auch kein Wort bei meiner Abreise.
Arbeitsdienst
Ab Fürth ging unser Transport mit vielen jungen Menschen, darunter auch wir Ansbacher, über Hamburg-Stade nach Sahlenburg bei Cuxhafen. Es war das erste Mal, dass ich eine solche große Reise machte. Interessiert saß ich am Fenster und genoss den Landschaftswechsel der draußen vorüberzog. Besonders faszinierte mich die Lüneburger Heide in Herbststimmung.
Nach ungefähr 2 Wochen Aufenthalt in Sahlenburg, marschierten wir bei Ebbe durch das Watt, oftmals auch hüfthoch durch die Priele, hinüber zur kleinen Insel Neuwerk vor der Elbmündung. Dort eingetroffen, begann unsere vormilitärische Ausbildung.
Nach einigen Wochen erhielt ich den Bescheid, dass ich weiterhin hier beim Arbeitsdienst, als Ausbilder verbleiben sollte. Hätte andere dieser Bescheid mit Freude erfüllt, für mich war er niederschmetternd.
Wie viele andere junge Menschen damals, sah ich meine Zukunft als Frontsoldat und nicht als Ausbilder in diesem Lager. Wie oft wurde uns in den damaligen Medien mit heroischen Berichten die tapferen Helden der Nation, die jungen Ritterkreuzträger vorgeführt und zum Idol gemacht. Verbohrt wie wir damals waren, es kam bei uns an. Wir wollten ebenso solche Helden werden.
Die einzige Möglichkeit von hier weg zu kommen, wäre eine längere Krankheit gewesen, aber von wo diese hernehmen.
Wie erhielten damals unsere tägliche, kleine Zigarettenration. Da ich Nichtraucher war, hob ich sie auf und sammelte sie. Meine Kameraden rieten mir, diese Zigaretten zu essen und dadurch einen Magen- oder Darminfekt herbeizuführen. Den ganzen Tag über kaute ich mit Abscheu den Tabak und schluckte ihn hinunter. Abends kam die Wirkung. Es wurde eine grauenvolle Nacht — mir war hundeelend und ich musste mich laufend übergeben.
Am Morgen war alles vorbei — vorbei, auch die Krankmeldung.
Nun gab es weiteres auszuspinnen. Ich war besessen davon, von dieser Insel wegzukommen.
Da wir des öfteren Boote entladen mussten, sah ich da eine Möglichkeit einen Unfall vorzutäuschen. Am nächsten Tag legte ein Kutter mit Versorgungsgütern an. Ich war während des Entladens noch in Gedanken, wie ich einen Unfall bewerkstelligen sollte, als sich eine Kiste aus dem Ladegeschirr löste und mir auf den verlängerten Rücken fiel. Der herbeigerufene Arzt stellte einen Steißbeinbruch fest. Ich hatte bis dahin überhaupt nicht gewusst, dass ich ein Steißbein habe. Jetzt wusste ich, wo es saß.
Mit einem kleinen Boot wurde ich nach Cuxhafen ins Lazarett gebracht. Es war ein sehr schmerzhafter Abschied von der Insel Neuwerk.
Hier im Lazarett kam ich das erste Mal näher mit verwundeten Frontsoldaten in Berührung. Trotz ihrer Verwundungen waren sie noch alle besessen vom Kampf ums Vaterland. Während sich diese Soldaten in den kurzen Flügelhemden frei und ungeniert bewegten, soweit sie es konnten, war ich ängstlich darauf bedacht meine Blöße zu verdecken. Krankhaft hielt ich mein Hemd im unteren Bereich zusammen, wenn ich mein Bett verließ — vor allem, vor den beiden Krankenschwestern, die uns betreuten. Doch diese kannten kein Erbarmen mit mir. Obwohl ich mich furchtbar schämte, wurde ich von ihnen splitternackt erbarmungslos und mit viel Wasser und rauher Seife am ganzen Körper abgeschrubbt. (engl.scrubbed away)
Bei vielen Menschen mindert Untätigkeit den Appetit. Bei mir war hier im Lazarett das Gegenteil der Fall. Waren es in den ersten Tagen 4 — 6 Brotstullen (bread sandwiches) zum Frühstück, die anderen aßen vielleicht 3, steigerte sich mein Appetit, zur Verwunderung der Kameraden und Schwestern, einige Tage später auf bis zu 16 Stullen, die ich vertilgte. Vielleicht trug dies auch zur schnelleren Genesung bei.
Als ich im Dezember erfuhr, dass meine Kameraden auf der Insel Neuwerk entlassen würden, wollte auch ich heim. Bei Untersuchungen versuchte ich nun eine Heilung vorzutäuschen. Diese waren aber immer so schmerzhaft, dass ich mich im Unterarm verbiss um die Schmerzen ertragen zu können, was aber nicht unbemerkt blieb.
Vom Stabsarzt zur Rede gestellt, erzählte ich ihm von meiner Angst vor der Rückkehr auf die Insel Neuwerk und von meinem Wunsch Frontsoldat zu werden. Letzteres dürfte dafür ausschlaggebend gewesen sein, dass ich mit meinen Kameraden von der Insel Neuwerk, die Heimfahrt antreten durfte.
Es war ein kurzer Besuch daheim.
Schon anfangs April 1944, jetzt 17 Jahre alt, wurde ich zum Panzer-Regiment 35, der 4. Pz-Division nach Bamberg eingezogen. Wir waren 16 Ansbacher, darunter meine Schulkameraden Georg Schlagbauer, Fritz Nölp und Hermann Schröder.
Wieder war es ein schmerzlicher Abschied von daheim, denn mein Vater sprach noch immer nicht mit mir.
Militärdienst
Die ersten Tage in der Kaserne verliefen wohl nicht anders, als bei anderen Rekruten. Doch bald hatte ich das erste tiefgreifende Erlebnis. „Aufstehen, aufstehen", diesen Ruf hatte ich noch im Ohr, als mir jemand die Decke wegriss. Schlaftrunken und in der Meinung, es wäre einer meiner Kameraden, gebrauchte ich das Zitat des Götz von Berlichingen. (...leck mich am Arsch!) Die Schreie des vor Wut schäumenden Offizier vom Dienst werde ich nie vergessen.
Mehrere Nächte lang schrubbte ich nun die Toiletten-Anlagen, nicht nur die unseres Zuges, sondern die der gesamten Kompanie.
Den damaligen Drill und die oft unmenschlich harte Ausbildung hatte auch ich zu ertragen, wie jeder andere Rekrut in dieser Zeit. Immer aber versuchte ich, mein Bestes zu geben und ein guter Soldat zu werden.
 |
| In der Zeit der Ausbildung |
Es war Ende Februar, wir hatten einen sehr langen Geländemarsch durch Schneereste und Matsch hinter uns. Die Füße in den Knobelbechern (deutsche Stiefel) hatten wir, wie üblich, nur mit Fußlappen eingewickelt. Ich hatte mir Blasen gelaufen, die nun aufgeplatzt waren. Die Wunden waren aufgescheuert und hatten sich entzündet.
Mit anderen Kameraden stellte ich mich am nächsten Morgen vor den Sanitätsbereich, um mich behandeln zu lassen. Aber es kam nicht dazu.
Über den Kasernenhof kam ein Leutnant unserer Kompanie auf uns zu, - fixierte die Gruppe, dann mich. Dann hob er den Arm, das Bild habe ich heute noch vor Augen und wies mit dem Finger auf unsere Unterkunft.
„Diensttauglich" war sein einziges Wort. Wortlos, was sollte ich auch sonst machen, machte ich kehrt und marschierte zurück. Für mich brach die gerechte Welt zusammen und ich schwor mir, was immer auch sei, mich niemals mehr krank zu melden. Mit zusammen gebissenen Zähnen, die Schmerzen in den Stiefeln wurden unerträglich, versuchte ich meinen Dienst weiter zu machen.
Es dauerte nicht lange bis mein Verhalten meinem Gruppenführer auffiel und er mir befahl, die Stiefel auszuziehen und ihm meine Füße zu zeigen. „Um Gottes willen, sofort in den Sanitätsbereich!", war sein Kommentar.
Dort ging nach der Behandlung der Stabsarzt auf mich los. Er bezichtigte mich der Selbstverstümmelung und wies mich auf deren Folgen hin. Notgedrungen erzählte ich ihm vom Vorfall mit dem Leutnant.
Nun lag ich 4 Tage im Sanitätsbereich, wo meine Füße wieder in Ordnung gebracht wurden. Was ich aber die weitere Zeit, nach der Genesung, unter dem Leutnant erleiden musste, brauche ich wohl nicht mehr erwähnen.
Mit der Verpflegung waren wir sehr zufrieden. Sie war gut und reichlich. Hier gab es das, was es daheim nicht gab, - es in dieser Zeit in den großen Familien nicht geben konnte. Nun hatten wir auch die schwarze Uniform, das Panzerkleid, erhalten, die Vereidigung stand kurz bevor.
Aus jedem Zug wurde ein herausragender Soldat ausgesucht, der während der Eid Sprechung, symbolisch für seine Kameraden die Fahne berühren durfte. Zu dieser Feier durften wir unsere Eltern einladen. Meine Mutter kam mit dem Zug angereist und erlebte, wie ihr Sohn Hans stolz an der Fahne stand. Das ganze Zeremoniell, die lauten Kommandos, das Knallen der zusammenschlagenden Stiefelabsätze und dann der feierliche Klang der Trompete, - ich glaube meine Mutter war genauso stolz wie ich.
Nicht aber mein Vater, der sich geweigerte hatte, mitzufahren. Er konnte es noch immer nicht verstehen und war noch immer beleidigt, dass ich zur Wehrmacht gegangen war. Einerseits hätte er mich daheim dringend gebraucht, andererseits war er und meine Mutter stets der Meinung gewesen, dass ich aufgrund meiner Krankheiten nicht eingezogen würde und machten sich sicher auch große Sorgen. Seine Vorstellung war, dass ich Beamter werde und damit vom Krieg verschont bliebe.
Wenn ich heute zurückdenke, hatte er in vielem recht. Was war ich damals mit meinen 17 Jahren?
In diesem Alter beginnen heute die meisten jungen Menschen erst ihre Lehre und sind körperlich und auch geistig viel weiter entwickelt, als wir es damals waren. Einmal mangelte es uns an der Ernährung, andererseits war das technische Zeitalter noch weit entfernt. Wir waren nichts anderes, so wie es mein Vater richtig sah, als das Kanonenfutter für einen Wahnsinnigen. Aber das sollten wir später erst selbst erkennen.
Nach der Vereidigung durften wir die Eltern durch die Stadt zum Bahnhof begleiten. Auf unserem Heimweg, wir waren eine Gruppe von vielleicht einem Dutzend Kameraden, trat ich versehentlich einem Kameraden von hinten auf den Fuß.
Der drehte sich um und ehe ich mich versah, schlug er mich mitten in der Stadt, vor dem Bahnhof zu Boden. Es war für mich deprimierend, vor all den vielen Menschen und keiner meiner Kameraden trat für mich ein. Sie alle hatten Angst vor ihm. Es war ein sehr kräftiger Bauernbursche mit schon dichtem Bartwuchs. Ich hatte vielleicht 2 - 3 Haare im Gesicht und verschwendete noch keinen Gedanken an das andere Geschlecht.
Seine Frauengeschichten, die er stets parat hatte, waren für mich schockierend. Angeblich hatte er schon alle Frauen seines Heimatortes beglückt, deren Männer an der Front waren. Als er nun weiter auf mich losgehen wollte, bat ich ihn mit weinerlicher Stimme, er solle mich daheim, aber bitte doch nicht hier, vor den vielen Menschen schlagen.
Angstvoll stand ich später vor unserer Unterkunft und traute mich lange nicht, die Treppe hoch zusteigen. Als ich dann unsere Stube betrat, wurde ich von ihm schon in Turnhose erwartet. Die Kameraden hatten ihn so weit gebracht, dass dieser Streit durch einen Ringkampf ausgetragen werden sollte. Im Unterrichtsraum standen wir uns gegenüber wie David und Goliath. Aus Angst und Verzweiflung sprang ich ihn überraschend an, bekam ihn gut in den Griff und nahm ihn in den Schwitzkasten und lies ihn nicht mehr los. Nun war es die Wut eines Kleinen, die immer getreten und schikaniert werden, die ihn fast erdrosselte. Die Kameraden mussten mich regelrecht von ihm wegreißen. Durch diesen Ringkampf hatte sich aber viel geändert. Von nun an war ich nicht mehr der Kleine und wurde fortan in Ruhe gelassen.
Sport war ein großer Teil unserer Ausbildung. Schon vor dem Frühstück liefen wir eine Stunde durchs Gelände. Die Freizeit verbrachten wir in der Kaserne, jedenfalls mein engerer Kameradenkreis.
Schon von daheim her war ich es nicht gewohnt, am Abend auszugehen. Dazu hatte ich nie Geld, andererseits gab es immer Arbeit und wenn auch nur der Hof noch zu kehren war.
Nun kam eine neue Freizeitbeschäftigung auf, das Boxen.
In jedem Zug wurde nun einer gesucht, der sich bereit erklärte, im Wettkampf gegen Boxer anderer Züge anzutreten. Nach vielem Drängen der anderen und auch durch den Sieg über meinen Zimmerkameraden bestärkt, willigte ich ein.
Als ich meinem Gegner gegenüberstand, groß und breit, überkam mich ein Zittern, das immer noch anhielt, als sie mir die Boxhandschuhe überstreiften. Nun vereinbarten wir noch, dass er nur mit verminderter Kraft gegen mich boxen dürfe. Der Kampf begann. Bald merkte ich, dass ich meinen Gegner durch meine Flinkheit beherrschte und drosch voll auf ihn ein. Ich kam immer mehr in Fahrt und forderte ihn auf, nun mit voller Kraft zu boxen. Trotzdem war ich nach einigen Runden der Sieger. Davon eingenommen stellte ich mich weiteren Gegnern. Doch diese, mit Boxerfahrung, schlugen mich durch Sonne und Mond. Die Boxhandschuhe hingen bald am Nagel. Zwei-, dreimal zugeschwollene Augen, das reichte.
Auf dem Bamberger großen Übungsgelände ging nun die Vorausbildung weiter. Auch die Einteilung, je nach Eignung, wurde vorgenommen, Panzerfahrer, Schütze und Funker. Ich wurde zum Letzteren benannt und erhielt nun dafür eine Spezialausbildung als Funker. Mit der Verlegung des Pz. Regiments am 29. Mai kamen wir nach Grafenwöhr. Schießübungen und Gefechtsschießen bei Tag und Nacht hatten nun Vorrang.
Am Abend hörten wir die Parolen der Reichsführung im Radio, aber kaum etwas von der russischen Sommeroffensive, die die Ostfront teilweise durchbrochen hatte. Auch die Invasion der Alliierten am 6. Juni in der Normandie wurde heruntergespielt.
Das Panzer-Regiment kam an die Ostfront und bezog bei Sokal, südlich von Minsk, eine Abwehrstellung. (II.Abteilung nach Umrüstung auf Panther)
Wir blieben bei der Ausbildungskompanie zurück. Inzwischen war ich zum Oberschützen befördert worden. Anfangs Juli wurden zwei Freiwillige für die Ostfront gebraucht. Ich war der Einzige, der sich sofort meldete. Alle anderen wollten lieber an die, wie sie glaubten, ruhige Westfront. Als der Kompaniechef ein Donnerwetter losließ, meine Kameraden als „Drücker" und „Feiglinge" bezeichnete, da sich aus der gesamten Kompanie nur ein Mann gemeldet hatte, nahm ich meinen, neben mir stehenden Schulkameraden Fritz Nölp an die Hand, der sich dann ebenfalls meldete. Wir hatten nun noch eine kurze Sonderausbildung. Mit dem Marschbefehl zur Jagdpanzerkompanie „1014" ging es nach Osten.
Wir erreichten mit dem Zug den großen Sackbahnhof Leipzig. Dort aß ich erstmals Froschschenkel in meinem Leben. Sie schmeckten mir sehr gut. Von Leipzig ging es weiter nach Berlin. Das Haus „Vaterland" ist für viele in Erinnerung geblieben, für mich war es ungeheuer beeindruckend. Es war eine ungeahnte, neue Welt, die ich da betrat.
Dieses Haus, oder besser als Palast bezeichnet, bot Tausenden von Soldaten auf ihrem Weg zur Front oder zum Heimaturlaub, einen unterhaltsamen Abend. Ein riesiger bestuhlter Saal, durch bengalisches Licht ausgeleuchtet, eine große Bühne von Scheinwerfern angestrahlt und Aufführungen, wie ich sie noch nie erlebt hatte.
Als eine Sängerin auftrat, vermeinte ich, dass sie während ihres Gesangs nur mir tief in die Augen sah. Mein Herz begann zu pochen. Es war das aller erste Mal, dass ich mich verliebt hatte.
Ihr Lied, ich habe es in mich hinein gesogen, später immer wieder gesungen und bis heute nicht vergessen.
„Ich hab heut Nacht den alten Mond gefragt, ob er mir treu, da hat er ja gesagt, da dacht ich mir wie schön es ist, ja bei der Nacht, wenn man sein Mädchen beim Wiedersehen
Youtube Lied
Youtube Lied
Ich konnte nachts vor Aufregung kaum schlafen.
Am Morgen ging es mit dem Zug weiter nach Osten. Mit dem Gefühl eine große Reise zu machen und andere Länder kennen zu lernen, stand ich am Fenster und sah hinaus. Wir fuhren durch Polen. Zerstörte Orte und schwarze Ruinen zogen draußen vorbei. Das war unsere glorreiche Wehrmacht, dachte ich bewundernd. An die Not, das Leid und den Schrecken, dass dieser Krieg bis dahin schon über viele Menschen gebracht hatte, daran dachte ich nicht. Wir waren erzogen und gedrillt, blindlings zu gehorchen, ohne zu fragen, ist das richtig?
So stand ich am Fenster und hielt mich oben an einem Griff fest. Als der Zug schüttelnd über eine schlechte Gleisstrecke, vielleicht auch Weiche fuhr, plötzlich das Quietschen der Bremsen. Viele flogen durcheinander. Ich hatte noch immer diesen Griff in der Hand als der Zug zum Stehen kam. Der vermeintliche Haltegriff war die Notbremse, die ich versehentlich gezogen hatte.
Ein älterer Schaffner stürmte ins Abteil und ging schimpfend auf mich los. Er wollte sofort die Strafe in Höhe von 5 Reichsmark kassieren, doch ich hatte kein Geld. Zum Beweis zeigte ich ihm meinen Brust Geldbeutel in dem ich den Rosenkranz den mir meine Mutter mitgegeben hatte, aufbewahrte, sonst war nichts darin. Als er dies sah, schüttelte er den Kopf und verließ ohne weiteren Kommentar das Abteil. Der Zug fuhr weiter. Es wurde Nacht. Nun kam die Angst, der Zug könnte angegriffen oder in die Luft gesprengt werden. Ich hatte von der Partisanen Tätigkeit gehört, aber wir erreichten am Morgen unangefochten unser Ziel vor Bara Novi. (Baranovice)
Vom Bahnhof wurden wir mit Beiwagenmaschinen zum Troß gebracht, der etwa 10 km hinter der Kampflinie lag. Wir wurden sofort unterrichtet, dass ein russischer Angriff zu erwarten sei. Erst später erfuhren wir, dass der Russe in seiner Sommer Offensive bereits die deutschen Stellungen durchbrochen hatte.
Mit Karabiner ausgerüstet wurden wir dem Sicherungszug zugeteilt, der vielleicht 1 km entfernt nach Osten lag. Kaum hatten wir diese Stellungen erreicht, ging es los. Russischer Fliegerangriff. Es krachte über uns und um uns. Erdbrocken und zersplitterte Äste fielen auf uns herab. Mit furchtbarem Angstgefühl erlebten wir diese erste Feuertaufe.
Der Schrecken des Krieges
 |
| Hans Oppel als Panzerschütze |
Nach ein paar Tagen musste ich mich beim Spieß melden. Ein Kradmelder brachte mich als Ersatz für einen gefallenen Funker an die Front. Es war mitten in der Nacht, als wir dort ankamen. In der Dunkelheit konnte ich ein größeres Gehöft mit mehreren Nebengebäuden ausmachen, zwischen denen ein paar Sturmgeschütze mit 7,5 cm Langrohr auf Panzerfahrgestellen des Typs IV, standen. Nach kurzer Meldung wurde mir ein Schlafplatz bei den anderen Soldaten zugewiesen. Ich musste gerade eingeschlafen sein, als es Alarm gab. Blitzschnell sprangen die Kameraden auf und stürmten hinaus. Ich hinterher! Jeder wusste wohin, nur ich nicht. Ratlos stand ich zwischen den Panzern, bis mir aus einem heraus zugewunken wurde.
Ein gewaltiger Anpfiff des Panzerführers, einem Leutnant, der erst nachließ, nachdem ich ihn erklären konnte, dass ich als Neuling erst vor kurzer Zeit angekommen wäre und noch keine Einweisung hatte. Nun nahm er mich erst richtig in Augenschein. Ich wusste nicht, was er dachte. Es war wie etwas Mitleid, das da plötzlich in seinen Augen stand. „Ein Bubi", hörte ich ihn zu den Kameraden sagen. „Bubi" dieser Name sollte mich bis ans Kriegsende begleiten. Wie ich bald erfuhr, hatten die Kameraden sehr viel Kriegserfahrung. Sie waren weit vorgestoßen und waren ebenso weit wieder zurückgejagt worden.
Sie vermieden es vorerst, von meinem Vorgänger zu sprechen. Erst im Nachhinein wurde mir klar, dass es das Schicksal gut mit mir gemeint hatte. Diese kampferprobten Kameraden lernten mir Neuling bald die Realität des Krieges.
Da wir in Bereitstellung lagen und im Gelände alles ruhig war, fragte ich meinen Kommandanten, ob ich mich etwas umschauen dürfte. Mit einem seltsamen Grinsen gab er die Erlaubnis. Ich soll mich aber nur in unmittelbarer Nähe aufhalten. Ich verließ das Gehöft und folgte einem kleinen Bach vielleicht 50 Meter aufwärts. Da sah ich sie, die ersten toten Gegner aus nächster Nähe. Etwas verstreut lagen sie am Bachufer, etwa ein Dutzend russischer Soldaten. So hatte ich mir den Krieg vorgestellt.
Naiv und neugierig wie ich war, schaute ich bei den Toten nach wo sie getroffen waren. Die meisten waren von MG-Salven durchsiebt. Ungerührt ging ich weiter. Etwas aufwärts lag auf einer Brücke eine große Bombe. Aus dem Gebüsch daneben klang ein Schnarchen und ich entdeckte eine deutsche Uniform.
Es waren zwei deutsche Posten, die vor Müdigkeit eingeschlafen waren. Wahrscheinlich hatte auch das gleichmäßige Plätschern des Baches dazu beigetragen. Ich war von dem hier in der Nacht Vorgefallenem noch so beeindruckt, dass ich dem im Moment keine Bedeutung beimaß.
Erst später, als ich an mein erstes Fronterlebnis zurückdachte, kam mir zum Bewusstsein, mit welchen Leichtsinn hier gehandelt wurde. Aber auch da wusste ich noch nicht, wie schwer es war, nach tagelangen Kämpfen als Beobachtungsposten die Augen aufzuhalten. Ihr Schlaf jedoch war nicht allzu tief. Durch ein leises Geräusch von mir fuhren sie erschreckt in die Höhe und griffen zu ihren Karabinern.
Ich erzählte ihnen, dass ich ein Neuer wäre. Zu einem weiteren Gespräch kam es nicht. Sie rieten mir sofort zurück zu gehen, der Iwan könnte jederzeit wieder angreifen, oder irgendwo da draußen könnten Scharfschützen lauern.
Ich dachte mir, sie wollten mir nur Angst machen, trat aber doch den Rückweg durch das Ufergebüsch an. Dann traf es mich wie ein Schock. Drei deutsche Soldaten alle mit Tapferkeitsauszeichnungen (Orden) lagen vor mir. Ebenfalls das erste Mal, dass ich den Tod von Kameraden vor den Augen hatte.
So hatte ich mir den Krieg nicht vorgestellt.
Der Druck der Russen wurde stärker.
„Vorwärts Kameraden, wir müssen zurück"!
Mag auch dieser damalige Spruch ironisch klingen, er verdeckt das Leid, die Not und die Verzweiflung, die bereits die Soldaten erlebt hatten und in diesen Tagen auch über die deutsche Bevölkerung im Osten hereinbrach.
Anfang August lagen wir nordöstlich vor Warschau in Abwehrstellung.
Nachdem hier das III. russische Panzerkorps total zerstört worden war, kam die Front zum Stillstand.
In Warschau tobte der Aufstand in der Hoffnung auf russische Hilfe, die sich nicht erfüllte. Er wurde niedergeschlagen. 120.000 tote Polen, wir hörten nur davon.
Unterdessen hatte ich mich mit meinen Kameraden gut zusammengefunden. Sie wussten meine gute technische Ausbildung und meinen Eifer zu schätzen und obwohl sie nur einige Jahre älter waren als ich, wurde ich von ihnen fast väterlich behandelt.
Der Nachschub klappte hier noch vorzüglich. Besonders über die Verpflegung und den Frontkämpferpäckchen waren wir begeistert, die wahrscheinlich bei den Soldaten, die vorne den Russen gegenüber im Dreck lagen selten ankamen.
Es waren so gute Sachen. Zucker, Kaffee, Kekse, Fleisch-und Wurstdosen, getrocknete Datteln und damals schon Schoko-Cola, die erst weit nach dem Krieg in den Handel kam.
In diesen Tagen hatte ich auch den ersten Rausch meines Lebens. Unser Kompanieführer, Hauptmann Kuhnle aus Karlsruhe, erhielt das Ritterkreuz für 64 feindliche Panzerabschüsse, das nun begossen wurde. Heute weiß ich noch nicht, wie ich den nächsten Tag verbrachte. Seither habe ich in meinem Leben kaum Alkohol angerührt. Da mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier, das war's.
Im September gelang es den Russen, den Nordabschnitt im Kurland zu durchbrechen. Eilends wurden wir nach dort verlegt und kamen im Raum Insterburg zum Einsatz. Nun erlebte ich selbst die Frontkämpfe, wie ich sie bisher nur aus Erzählungen kannte. Es war ein gegenseitiges Abschlachten und der Beginn der Zeit, wo die Ritterkreuzträger starben. Dies war kein Kampf mehr um den Sieg. Es war nur noch ein Kampf ums Überleben. Szenen, wie laut brüllende russische Soldaten aus ihren Stellungen heraus gegen unsere Panzer stürmten und in unserem MG-Feuer zusammenbrachen, kann man niemals vergessen. Aber auch bei uns wurden die Gräber mehr und die Panzer weniger. Heute ist dies alles für mich wie ein furchtbarer Traum. Wir schauten nicht mehr auf den Kalender. Datum und Zeit zählten nicht mehr.
Die Kälte war hereingebrochen, der erste Schnee war gefallen. Es war Oktober. Wir fuhren bei Insterburg in der Nacht zur befohlenen Abwehrstellung vor. Die Kompanie besaß gerade noch 4 Panzer. Damit sollten wir einen Abschnitt von mehreren Kilometern abriegeln.
Im ersten Morgengrauen gingen wir hinter einer Böschung in Stellung, so dass gerade das Kanonenrohr darüber ragte und wir freie Sicht hatten. „Leute", sagte unser Kommandant, „jetzt machen wir zuerst mal eine Jause". Als Norddeutscher meinte er mit diesem Ausdruck „eine Brotzeit", so wie wir es kennen. Als Proviant hatten wir einen gekochten Kalbsschenkel auf dem Panzer verstaut. Ich stieg nun vorsichtig aus der Luke um ihn zu holen. Nichts rührte sich. Das Fleisch war schon etwas gefroren. Trotzdem säbelten wir uns ein paar Scheiben ab.
Während meine Kameraden noch etwas schlafen wollten, hatte ich Wache zu halten.
Als es heller wurde sah ich, dass wir weniger als 300 Meter von den russischen Schützengräben standen, in denen nun das Leben erwachte. Ich sah sie hin und her gehen, hörte ihre Stimmen und das Klappern ihrer Kochgeschirre. Ich weckte den Leutnant. Der sah kurz hinaus. „Ruhig bleiben, damit wir nicht entdeckt werden und weiter beobachten" meinte er und kauerte sich wieder am Boden zusammen. In mir rebellierte schon länger mein Magen und Darm. Wahrscheinlich war es das kalte Fleisch, das ich gegessen hatte. Als es kaum noch auszuhalten war, erlaubte mir der Leutnant, den Panzer zu verlassen. Vorsichtig erledigte ich das Geschäft im Schutze des Panzers, wenn auch mit einem mulmigen Gefühl und stieg wieder ein.
Alles war ruhig und blieb es auch weiterhin. Die Russen vor uns bewegten sich unbekümmert in ihren Stellungen. Wir wähnten uns daher unentdeckt und in sicherer Stellung. Es dürfte so gegen 8.00 Uhr gewesen sein, als es über unseren Turm hinweg krachte und hinter uns einschlug. Am Fluggeräusch erkannte ich sofort, dies war eine Panzergranate. Während meine Kameraden nun hellwach waren und ihre Plätze einnahmen, krachte es zum zweiten Mal, diesmal schon näher. Ich sah das Mündungsfeuer und meldete „feindlicher Panzer, 1000 Meter, 12.00 Uhr".
„Motor anwerfen!" brüllte der Leutnant, und als dies nicht gleich geschah, nochmals und lauter: „Motor anwerfen!" Verzweifelt kam vom Fahrer zurück: „Herr Leutnant der Motor springt nicht an". Jetzt brüllend zu mir: „Bubi aussteigen und den Motor ankurbeln!", doch die letzten Worte gingen schon im Krachen unter, das nun über unseren Panzer hereinbrach.
Plötzlich nur noch Feuer und Rauch. In Panik drückte ich mein Kehlkopfmikrofon gegen den Hals und schrie: „Herr Leutnant, sollen wir ausbooten" und als keine Antwort kam, nochmals. Dies sind Momente, die man sich zeitlich nicht merken kann. Im Nachhinein fragt man, wie lange hat dies alles gedauert? Man weiß es nicht.
Als sich der Rauch im Panzer etwas lichtete, sah ich den Kommandanten und den Richtschützen bewegungslos im Panzer liegen. Vom Fahrer, bei dem die Granate eingeschlagen war, war nicht mehr viel übrig. Entsetzt zwängte ich mich durch die Panzerluke, warf mich hinter dem Panzer in Deckung und erwartete jeden Moment die anstürmenden Russen. Panische Angst kroch in mir hoch. Die Gedanken überschlugen sich. Was sollte ich tun? Ich wusste es nicht und fühlte mich grenzenlos allein. Die Stille, die plötzlich eintrat, trug noch mehr zu meiner Angst bei.
Plötzlich ein Geräusch am Panzer. Die Russen, dachte ich, jetzt sind sie da. Dann sah ich, es war der Richtschütze, der sich vom Panzer herabfallen ließ und bewegungslos im Schnee liegen blieb. Im ersten Moment ein ungeheueres Glücksgefühl, ich war nicht mehr allein.
Als ich zu ihm hin kroch, sah ich seine Verletzungen. An einer Hand fehlende Finger, ein Bein unterhalb des Knies weggerissen. Das Auge hing aus der Augenhöhle. Wie sollte ich ihn verbinden? Verbandszeug hatte ich nicht. Zu meinem Erstaunen trat kein Blut aus den Wunden. Schnell riss ich die Plane, in der wir immer zusätzliches Gerät verstauten vom Panzer herunter und wickelte ihn darin ein. Nur weg von hier. Der Gedanke, so makaber es heute auch klingen mag, gab mir Kraft und den Glauben, dass mein Kamerad, sollten die Russen hinter mir herschiessen, mein Schutzschild wäre.
Die Enden der Plane über die Schulter gezogen, meinen Kameraden wie einen Sack auf dem Rücken, die Deckung des Panzers ausnützend, erreichte ich ohne Beschuss den nahen Waldrand. Eines wurde mir sofort klar, ich durfte die Orientierung nach Westen nicht verlieren — es wurde ein weiter Weg. Bei kurzen Pausen, die ich Kräfte holend immer wieder einlegen musste, horchte ich angstvoll auf die Geräusche in der Umgebung.
Nach langer Zeit, es dürfte schon Mittag gewesen sein, erreichte ich ein paar Bauernhäuser. Als ich näher kam, sah ich vor einem größeren Haus viele verwundete Soldaten im Schnee liegen. Ich hatte gerade die Haustüre erreicht, als mir ein Sanitäter entgegen kam. Ich bat ihn, sich sofort um meinen Kameraden zu kümmern. „Ja, wenn du mithilfst", war seine Antwort. Gemeinsam schleppten wir ihn in eine große Stube zu einem der Ärzte.
Ohne jedes Betäubungsmittel, sägte er die aus den Wunden herausstehenden Knochen ab und wickelte mehr, als er nähte, Fäden um die Wunden. Verband angelegt. Der Nächste. Fertig.
Auf meine Frage warum der Kamerad nicht geblutet hätte, nur eine kurze Antwort: „Der Schock". Von diesem Kameraden, Fritz Neumann, 29 Jahre alt, Familienvater aus Leipzig, habe ich nie mehr etwas gehört.
Erst am späten Abend, nachdem ich mich immer wieder durchgefragt hatte, erreichte ich meine Kompanie und machte Meldung. Da nach meiner Meinung der Panzer wahrscheinlich noch fahrtauglich war, versuchten wir ihn am nächsten Tag zurück zu holen. Vergebens. Der Russe hatte ihn bereits vereinnahmt. Unter heftigem Schussaustausch mussten wir uns wieder zurückziehen.
Weihnachten 1944 gab es für uns nicht.
Der Russe griff immer stärker an, wir standen im stetigen Abwehrkampf.
Der Brückenkopf war nicht mehr zu halten. Nach dem Abschuss unseres Panzers hatte ich im Panzer des Kompanieführers als Funker und Ladeschütze meinen Platz. Schon bald hatte sich ein sehr freundschaftliches Verhältnis gebildet.
Heimat, deine Sterne ...
 |
| Lied Heimat Deine Sterne... |
Trotz dieser neuen Freundschaft hatte sich seit meinem Panzerabschuss in mir etwas verändert. Abgeschossene Panzer, an denen wir immer wieder vorbei fuhren, sah ich nun mit ganz anderen Augen an. Jetzt dachte ich auch jedes Mal an diese Soldaten, ob Deutsche oder Russen, denen diese zerschossenen Panzer vielleicht zum Grab geworden war — ein Schicksal, das mir selbst nur durch Glück erspart blieb. Aber jetzt wusste ich auch, dass jeder Einsatz der Letzte sein könnte.
Nun war ich froh, wenn wir hinter der Front im Schutze einiger Häuser in Bereitstellung lagen und mit anderen Panzerbesatzungen unserer Kompanie für einige Stunden zusammen saßen. Es waren die schönsten Zeiten unseres Frontlebens.
Wie immer hörten wir den Wehrmachtssender und glaubten auch, zumindest wir Jungen, diesen damaligen Lügen. Schon bald aber wurde er von den älteren Kameraden ohne jeglichen Kommentar ausgeschaltet. Bald sang einer ein Lied, das kurz vorher im Radio zu hören war. Oft war ich es, da ich schon damals und mein ganzes Leben hindurch immer wieder gerne sang. Andere stimmten ein, manchmal holte auch ein Kamerad eine Mundharmonika aus der Tasche und begleitete unseren Gesang, der bis auf die Straßen hinaus klang und weitere Kameraden anzog.
Obwohl wir neben den schönen Heimat- auch Soldatenlieder sangen, war doch der Schrecken des Krieges in diesen schönen Stunden vergessen und doch holte er uns auch hier immer wieder ein.
Mit dem damaligen neuen Lied von der „Lilly Marleen" kam er wieder und mit „Heimat deine Sterne", endete meist unser Liederabend. Mit Tränen in den Augen sah ich viele ältere Kameraden die Stube verlassen. Auch mich zog es hinaus ins Freie.
Wie so oft sah ich bei klarem Wetter hinauf zum nächtlichen Sternenhimmel, mit Gedanken an daheim. Standen über Ansbach dieselben Sterne? Vielleicht, schaute jetzt auch die Mutter hinauf und denkt an mich. Wie war das früher, als wir am Weihnachtsabend durch die verschneiten Straßen zur Christmette gingen, mit dem Blick hinauf zu den Sternen, aber damals mit dem Gefühl der Geborgenheit.
Hier klang aus der Ferne das bekannte Grollen der Front. Leuchtkugeln flimmerten über den östlichen Horizont, doch im Norden stand ein Stern, der heller strahlte als andere. Als Kinder nannten wir ihn den Abendstern, weil er als erster Stern am abendlichen Himmel stand. Hier weckte er so viele Erinnerungen in mir an diese Zeit und plötzlich hatte ich das Gefühl, dies ist ein Stern, der schützend über mir steht. Damals hatte ich noch keine Ahnung, dass ein Stern mein ganzes weiteres Leben bestimmen würde.
An einem dieser Tage, wir standen in einer kleinen Ortschaft direkt an der Front, tauchte plötzlich ein russischer Lkw auf und versuchte, als er plötzlich deutsche Panzer sah, zu flüchten. Ich glaube, die Überraschung war auf beiden Seiten. Er kam nicht weit. In einer Scheune war sein Fluchtversuch zu Ende. Das hölzerne Scheunentor war zwar zersplittert, aber die gemauerte Rückseite hielt dem Aufprall stand.
Schnell wurde der russische Soldat unter dem Lkw hervor gezogen unter dem er Schutz gesucht hatte. Es war ein junger Bursche, ungefähr in meinem Alter. Im folgenden Verhör, in dem sich herausstellte, dass er sich grenzenlos verfahren hatte, wurde er als Hilfe der Feldküche zugeteilt. Somit hatte ich öfter die Gelegenheit, mich mit ihm zu unterhalten, was natürlich mit Händen und Füßen, Bleistift und Papier geschah.
Er hieß Iwan, auf deutsch Hans wie ich, und stammte aus der Moskauer Gegend. Sie waren sechs Brüder gewesen, fünf waren schon gefallen.
Wir hatten bald ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Er freute sich immer, wenn ich bei ihm vorbei kam. Als ich ihn längere Zeit nicht mehr gesehen hatte und daher nach ihm fragte, hieß es, er wäre abgeholt worden und er hätte sein eigenes Grab schaufeln müssen. Auf meine Frage warum, habe ich keine Antwort erhalten.
Der Winter war in voller Härte über uns gekommen. Das Kreisen der russischen Aufklärer, neben den üblichen dauernden Luftangriffen, nahm zu. Jeder wusste, es braute sich drüben etwas zusammen. Am 13. Januar war es soweit. Der Russe hatte südlich von uns, bei Goldap, die deutsche Front durchbrochen und stieß mit gewaltigen Kräften nach Westen und auch in unseren Raum, nach Königsberg vor. Wir hatten damals von diesem Ausmaß noch keine Ahnung. Aber jetzt begann auch für mich ein Krieg, wie ich ihn bisher nicht kannte. Erbitterte Abwehrkämpfe gegen eine immense Übermacht. Rückzug und wieder in Abwehrstellung. Das Entsetzlichste aber waren die Flüchtlinge, die in heilloser Flucht nach Norden zur Ostsee strömten und nun zwischen die Fronten gerieten.
Wir Soldaten hatten in diesen Tagen im ständigen Abwehrkampf fast jede Orientierung verloren. Nur anhand von Ortstafeln und Wegweisern, wussten wir in etwa, wo wir uns befanden. Stetig ging es nach Westen.
Wir standen in einem größeren Ort in Deckung der Häuser, als uns wieder, wie so oft, schweres Artilleriefeuer eindeckte. Mein Kamerad Nölp, der sich gerade in einem der Häuser befand, wurde durch einen Treffer unter den Trümmern verschüttet. Schwer verletzt konnten wir ihn bergen und ich brachte ihn zum Verbandsplatz. Als wir uns dort trennten, wussten wir nicht, ob wir uns noch einmal wiedersehen würden. Er hatte Glück. Nach einem längeren Lazarett Aufenthalt erreichte er noch vor Kriegsende die Heimat.
Es war aber nicht nur mein Kamerad Nölp, der uns verließ. Es wurden immer mehr. Unsere Kompanie wurde immer kleiner.
In einem fürchterlichen Schneesturm, der mehrere Tage anhielt, und da der Boden hart gefroren war, konnten wir uns weiter absetzen. Ende Januar erreichten wir Frauenburg. Hier war unser Rückzug nach Westen zu Ende. Der Russe hatte mit der Einnahme von Elbing am 22. Januar, den Ring um Ostpreußen geschlossen.
Wir standen nun, die frische Nehrung im Rücken, in einem 15 km breiten Brückenkopf, in dem aus dem Süden kommenden Massen von Flüchtlingen strömten, um über die gefrorene Nehrung die Ostsee zu erreichen.
Aus Resten zerschossener Einheiten, die sich Hunderte von Kilometern durchgekämpft hatten, wurden neue Verteidigungslinien gebildet, ohne Rücksicht auf die Waffengattung. Viele davon trugen blutgetränkte Verbände.
Parolen über Wunderwaffen, die bald eingesetzt würden und vom Ersatz, der den Ring aufreißen würde, ja selbst vom glorreichen Endsieg, war überall zu hören.
Trotzdem standen Hitlerjungen und Greise als Kanonenfutter in den Schützengräben. Wie es denen erging, die nicht mehr mitmachen wollten, erlebte ich grausam an einem dieser Tage.
Ein Kradmelder fuhr mich, nachdem ich vom Kompaniechef den Befehl erhalten hatte, zu einer etwa 2 Kilometer entfernten kleinen Sandgrube. Dort warteten schon ein paar Soldaten und ein Offizier. Ich bekam einen Karabiner, dann mussten wir antreten. In Kürze erklärte er uns, es würde gleich ein Soldat gebracht werden, den wir zu erschießen hätten. Er würde nicht sprechen. Wir hätten auf sein Zeichen zu achten. Säbel heben, heißt anlegen und entsichern, Säbel senken, schießen. Ein Kübelwagen brachte kurz darauf einen abgekämpften jungen Menschen im zerschlissenen Kriegsmantel ohne Koppel.
Wir wussten nicht, was er verbrochen hatte. Was der Offizier vorlas, konnte ich nicht verstehen. Er sprach sehr leise. Dafür aber lauter der Soldat, der den Offizier um Gnade bat. Es täte ihm leid und er würde seine Aufgaben weiterhin erfüllen. Zu Hause hätte er ein Kind und eine Verlobte. Er wäre erst 29 Jahre alt.
Wortlos wies der Offizier auf eine Art Baumstumpf, an den ihn nun seine Bewacher banden.
Ein Pfarrer, der bei ihnen war, sprach noch ein Gebet mit ihm, dann wurden ihm die Augen verbunden. Der Säbel hob und senkte sich. Die Kugeln hatten ein faustgroßes Loch in seine linke Brusthälfte gerissen.
Als mich der Kradmelder wieder zurückgebracht hatte, fragt ich den Kompaniechef, warum er gerade mich dazu abkommandiert hätte. Darauf nur eine kurze Antwort: „Einer musste es tun".
Von neuen Kameraden, die uns aus anderen Einheiten zugeteilt worden waren, erfuhr ich, dass dies ein bewusstes Vorgehen war. In den größeren Orten oder Städten wurden diese sogenannten „Feiglinge" erschossen und dann zur Abschreckung aufgehängt. Hier an der Front sollte das Zusammenstellen der Erschießungskommandos aus verschiedenen Kompanien, denselben Effekt erzielen.
Als ich mich einmal später den Kompaniechef gegenüber skeptisch zum Endsieg äußerte, meinte er: „Bubi, halt den Mund. Du hast selbst erlebt, was Dir passieren kann".
Ich war nun 18 Jahre alt. Wir standen immer noch im Raum Frauenburg.
Mittlerweile wussten wir, dass wir eingekesselt waren. Am Tag war es die russische Artillerie und die Luftangriffe, die uns keine Ruhe ließen, nachts schaufelten die Russen aus ihren Bombern Brandbomben herab. Aber ungeachtet dessen kamen immer noch Flüchtlinge und versprengte Kameraden an.
Dann kam der 12. Februar.
Mit unserem letzten Panzer hatten wir einen Vorstoß durchzuführen. Der Russe drängte hier weiter nach vorne und versuchte, einen Strom Flüchtlinge und Infanteriekräfte einzuschließen. Wir hatten den Auftrag, diese Absetzbewegung zu sichern und die Russen aufzuhalten.
Begleitet von einem SS-Panzer, Typ Panther, fuhren wir vor. Schon nach einem Kilometer meldete uns dieser einen Motorschaden. Mit ungutem Gefühl und in der Hoffnung, dass noch weitere Panzer anderer Einheiten eingesetzt wären, fuhren wir weiter.
Zerschundene, dreckige Landser, viele verwundet, kamen uns entgegen und dazwischen Tausende ausgemergelter Flüchtlinge zu Fuß oder auch mit Pferdegespannen, mit kleinen Leiter- und auch Kinderwagen. Wir kamen nicht mehr weit.
Wir hatten gerade unsere vordersten Stellungen erreicht, da kam der Russe. „Urrä, urrä", das Geschrei kannten wir. „Ruhig bleiben, rankommen lassen" war der Befehl des Kommandanten. Dann, als wenn er seiner Angespanntheit Luft machen würde, laut schreiend: „Jetzt, Feuer". Auf kurze Distanz Dauerfeuer auf eine Masse anstürmender Gegner. Man kann das Gefühl nicht beschreiben, das einem in einen solchen Moment durch den Körper kriecht. Wahrscheinlich ist es die furchtbare Angst und der Selbsterhaltungstrieb, die einen leiten. Granaten in höchster Schussfolge. Das MG, man lässt es nicht mehr los. Man sieht sie zusammenbrechen. Sie kippen wie Grashalme, die eine Sense abmäht. Die eigenen Schreie, aus dieser Angst heraus, man hört sie nicht.
Wir hatten es geschafft, der Angriff stockte. Viele Tote zurücklassend zog sich der Russe zurück. Dann sahen wir eine russische Pak, (Panzerabwehrkanone) die uns ins Visier nahm. Wir waren schneller. Unser Geschoss durchschlug die Panzerung. Beim Abdrehen krachte es in unseren Panzer hinein. Eine Granate aus dieser Pak fetzte uns das Antriebsrad weg. Unser Panzer war unbeweglich. Schnell booteten wir aus und ich spürte, wie es heiß in meinen Unterschenkel fuhr. Er schmerzte, aber der Fuß ließ sich bewegen. Von Deckung zu Deckung, stets unter Beschuss, arbeiteten wir uns zurück. Der Arzt stellte fest, zwei Steckschüsse. Ein angelegter Verband und ich ging wieder zu meinen Kameraden zurück. Ich wollte nicht im Lazarett bleiben, da ich dann kaum eine Chance gehabt hätte, wieder zu meiner Kompanie zu kommen.
Auch die „Razzien", die man dort durchführte, hatten sich mittlerweile bis zum letzten Landser durchgesprochen.
Unsere Jagdpanzerkompanie hatte aufgehört, zu existieren. Nun waren wir als kleine Gruppe, trotz Panzerkleidung, bei der Infanterie gelandet. Statt unserer Jagdpanzer hatten wir nun Karabiner, ein MG 42, Haftminen und einen „Panzerschreck", ähnlich der späteren amerikanischen Bazooka, mit der man panzerbrechende Geschosse auf 150 m gezielt abfeuern konnte.
Ich möchte mich über die nächsten furchtbaren Wochen nicht weiter äußern. Wir erhielten den Befehl, uns nach Heiligenbeil abzusetzen. Was wir damals nicht wussten war, dass wir der Samlandfront zugeteilt waren.
Auf diesem Marsch stießen wir bei Braunsberg auf einen Jagdpanzer, der Verlassen und scheinbar unbeschädigt in hohem Gestrüpp unter Bäumen stand. Ringsum Gefallene, sonst kein Leben.
Wir untersuchten den Panzer, konnten aber keinen wesentlichen Schaden feststellen. Der Schlüssel steckte, der Motor sprang an. Wir beschlossen, uns den Panzer auszuleihen. Als wir los fuhren, unser Kompaniechef stand in der offenen Panzerluke, trat ein Feldwebel aus dem Gebüsch und winkte freundlich.
Als wir ein kleines Gehöft erreichten, oder das was davon noch übrig war, entdeckten wir vor uns eine riesige Menschen Kolonne, die auf uns zukam. Es war ein jammervoller Zug von russischen Kriegsgefangenen auf hölzernen Sohlen, mit tief herabgezogenen Mützen und Papier Kordel um die auseinander fallenden Mäntel gebunden.
Ausgemergelte, verfrorene, halb verhungerte Menschen auf einem Marsch ins Ungewisse. Ich schaute ihnen lange nach, es war eine ungeheure Zahl und stellte mir die Frage: „Wird es dir auch so ergehen?"
Um Heiligenbeil tobten schwere Kämpfe. Trotzdem starteten und landeten dort auf dem Flugplatz noch deutsche Flugzeuge.
Wir marschierten, unter dem Schutz der Luftabwehr von Heiligenbeil und Kahlholz nach Balga. Von dort setzten wir, es dürfte um den 25. März gewesen sein, nach Pillau über und gehörten nun zur Samlandfront. Aber was war dies für eine Einheit.
Neben uns deutschen Soldaten kämpften nun russische Hilfsfreiwillige und Freiwillige anderer Länder gegen die Russen, die schon an die Bernsteinküste vorgedrungen waren. Wir schafften es bis kurz vor Königsberg — dann warf uns der Russe zurück.
Mit 4000 Kameraden waren wir in Pillau angetreten, 300, viele davon verwundet, erreichten Mitte April wieder den Ausgangspunkt, der nun bereits vom „Freien Deutschland" besetzt war.
Nachdem sie Uhren und Schmuck abkassiert hatten, ließen sie uns mit unseren Waffen zur Frischen Nehrung übersetzen.
Wir hatten in diesen zwei Wochen nicht nur die schrecklichsten und verlustreichsten Kämpfe erlebt, wir sahen auch die grausamen Ausmaße der Flüchtlingstragödie von Pillau nach Königsberg und später auf der Frischen Nehrung.
Zwischen den zerstörten Militärfahrzeugen, liegengebliebener Hausrat, zerschossene Fuhrwerke, viele Tierkadaver und Tausenden toten Menschen und Soldaten, Frauen, alte Männer und Kinder, die jetzt der Schnee freigab. Von den russischen Hilfsfreiwilligen der Samlandfront habe ich ab dort nie mehr etwas gehört.
Weiter Rückmarsch auf der Frischen Nehrung. Bei diesen Rückzugsgefechten, bei denen wir immer im Dreck lagen, stellte der Russe zwischendurch das Feuer ein. Dann dröhnten laut deutsche Lieder aus Lautsprechern, von den russischen Stellungen herüber. Es waren unsere Lieder, die wir immer bis dahin gesungen hatten. Vor allem das Lied von der Lili Marlen. Dann eine deutsche Stimme, ich höre sie noch heute. Damals für mich unfassbar: „Deutsche Soldaten, euer Krieg ist verloren. Legt die Waffen nieder und ergebt euch. Wir versprechen euch, ihr habt gutes Essen und schlaft jede Nacht mit einer hübschen Frau in einem weißen Federbett". Dann wieder Musik und dann wieder die Granaten. Ich weiß nicht, ob Kameraden dieser Aufforderung gefolgt sind. Ich habe aber gehört, dass sich zu dieser Zeit deutsche Offiziere erschossen haben. Es war die Aussichtslosigkeit und die Verzweiflung, da sie wussten, dass sie auf Befehl rücksichtslos, ohne jeden Sinn noch tausend junge Menschen in den Tod schicken mussten. Ein geäußerter Zweifel am Endsieg, der noch mit dem Einsatz von Wunderwaffen propagiert wurde, bedeutete ebenfalls das Todesurteil.
Dies allein beschreibt die damalige Lage.
Meine Hoffnung war mein Stern, der immer wieder über mir stand und für mich auch eine Verbindung zur Heimat war.
Die ununterbrochenen Luftangriffe und der Beschuss durch schwere Artillerie vom Festland herüber, zwang uns tagsüber in die Deckungslöcher. Nachts, entlang der zerstörten Flüchtlingstrecks und über die vielen Toten hinweg, arbeiteten wir uns Kilometer um Kilometer, von Hunger und Durst gepeinigt, zurück.
Wir erreichten Neukrug, erhielten dort wieder Verpflegung und marschierten weiter nach Kahlberg. Dann weiter westlich bis in die Nähe von Bodenwinkel.
Dort wurde aus ankommenden Soldaten wieder eine Verteidigungslinie erstellt. Da die Gefahr bestand, dass der Russe mit Booten über die Nehrung übersetzen könnte, hatten wir diesen Abschnitt zu sichern. Ich war am Ende meiner Kräfte. Seit Tagen plagte mich schon ein Schweißdrüsenabszess, der mir nun aufgeschnitten wurde.
Versorgung erhielten wir über den Seeweg. Das Artilleriefeuer hatte auch nachgelassen, nur die Tiefflieger schossen noch auf alles, was sich bewegte.
Aus meiner Deckung heraus wurde ich zum Kompaniechef gerufen.
„Bubi" sagte er, auch bei ihm war ich der Bubi, „ich habe schon lange das „EK II" für dich beantragt, das Du Dir schon längst verdient hast. Jetzt kommt keines mehr". Er nahm im Beisein des Spieß, der dies notierte, sein eigenes ab und steckte es mir an die Brust. Es war für mich ein tiefgreifender Augenblick. Zum Erwerb des Ritterkreuzes kam ich in meinem jugendlichen Wahn an die Front, diese Auszeichnung und die besondere Art der Überreichung war für mich mehr.
Doch dies sollte nicht die einzige Freude sein. Auf wundersame Weise erreichte mich hier ein Brief meiner Mutter. Anscheinend waren meine letzten Briefe an sie nicht angekommen. Zumindest erwähnte sie nichts davon. Ihr Brief war fast 8 Wochen unterwegs gewesen.
Sie schrieb aus Weinberg, wohin sie Vater mit den Geschwistern gebracht hatte, weil es in Ansbach zu unsicher geworden war. Sie habe lange nichts mehr von mir gehört und hoffe, dass es mir gut gehe.
Dann schrieb sie allgemein von der Familie. Werner, der jüngste Bruder, jetzt etwas über ein Jahr alt, mache die ersten Gehversuche. Sie schrieb, als wolle sie mir eine schreckliche Nachricht vorenthalten, die sie mir aber doch mitteilen musste.
Ansbach wurde Ende Februar bombardiert. Schwer getroffen wurde der Bahnhof und die Post. Es gab viele hundert Tote und auch Schwester Else kam dabei ums Leben. Sie wurde nicht einmal 20 Jahre alt. Schwester Anni mit 16 Jahren bei der Feuerwehr wurde schwer verletzt.
Hans, komm gesund wieder heim.
Ich hatte schon viele Kameraden gesehen, die mit einem Brief in der Hand, irgendwo in einer Ecke saßen und weinten. Jetzt ging es mir genauso. Was wurde uns vor knapp einem Jahr noch alles in Bamberg erzählt, schon die damaligen Bombenangriffe, sie wären nur zwischenzeitliche Erscheinungen. Bald würde kein einziges feindliches Flugzeug am deutschen Himmel zu sehen sein. Von Tapferkeit und Treue. Große Phrasen vom Endsieg. Nun, ich hatte ihn schon zu oft gelesen, diesen Spruch „tapfer und treu". Es waren die Grabinschriften vieler Kameraden. Ich hatte die Schnauze voll und wollte heim. Von unserer ehemaligen stolzen Kompanie waren gerade noch drei Mann übrig geblieben. Der Kompaniechef, Hauptmann Kuhnle aus Karlsruhe, der Fw. Westhoff aus Bad Oeynhausen und ich.
In den ersten Maitagen war es dann soweit. Mit dem Motorschiff „Weserstrom" verließ ich mit ungefähr 2000 Kameraden die Frische Nehrung. Unbelästigt, wir hatten immer noch Angst vor U-Boot-und Luftangriffen, erreichten wir über die Ostsee die Reede vor Kiel, an der bereits viele Schiffe mit Soldaten und Flüchtlingen lagen. Erst nach einer Woche durften wir im Neustädter Fischereihafen an Land gehen. Eskortiert von englischen Soldaten marschierten wir durch die Stadt und hatten ein sehr freudiges, unerwartetes Erlebnis. Frauen und Mädchen überreichten uns als Willkommensgruß in der Heimat Blumen. Der Krieg war zu Ende.
Eine kaum bewachte, eingezäunte Viehweide wurde unser Gefangenenlager. Mit Feldwebel Westhoff, der immer noch bei mir war, schlich ich mich nachts aus dem Lager und wir marschierten nach Süden.
Eine gewaltige Menschenmenge bewegte sich über die Straßen. Frauen mit Kindern, ihre Habseligkeiten in Kinderwagen oder auf Leiterwagen verstaut, Zivilisten mit Gehhilfen, Bauern mit Gabeln und Rechen auf den Schultern, es waren verkleidete Soldaten und wir in Panzeruniform; ich noch das EK II an der Brust, alles drängte sich zwischen den englischen Militärfahrzeugen nach Süden.
Die wenigen Kontrollen konnten wir anfangs noch umgehen, später wurden wir einige Male aufgegriffen, was aber unsere weitere Flucht nicht verhindern konnte. Bei Bauern bettelten wir um Essen. Nachts oder auch am Tag schliefen wir in Scheunen und Geräteschuppen oder auch im Freien.
Die größeren Städte umgingen wir. Bei Blankenese setzte uns ein Fischer mit einem Ruderboot nachts über die Elbe. Wir durchquerten die Lüneburger Heide und erreichten einen Bauernhof bei Soltau, wo wir freundlich aufgenommen wurden und wir uns einige Tage ausruhten. Dort wurden wir von einer vorbeifahrenden Militärstreife entdeckt. Unsere Heimreise war vorerst zu Ende, wir landeten im nahen Gefangenenlager (Munsterlager).
Es geht nach Hause
Das Essen war knapp. Die Behandlung nicht gut. Vielleicht hat dafür auch die Entdeckung des nahen KZ Bergen-Belsen mit den begangenen Grausamkeiten dazu beigetragen. Mit Freude nahm ich daher Mitte August meine Entlassungspapiere entgegen. Ich durfte heim.
Mit Lkw,s wurden wir zu einem nahen Bahnhof gebracht. Unterwegs sah ich auf einem anderen Lkw meinen Schulkameraden Fritz Dörr und Walter Grönert, der so alt wie Bruder Karl war. Am Bahnhof wurden wir in einen Zug geschoben, der uns nach Hannover brachte. Meine beiden Ansbacher verlor ich dabei aus den Augen. Die weitere Heimfahrt habe ich nur noch in schlechter Erinnerung. Aber die riesigen Menschenmengen, die auf den Bahnsteigen standen, mehr als die Züge aufnehmen konnten, werde ich nie vergessen. Wie Trauben hingen sie außen an den Waggons, saßen auf den Dächern und klammerten sich auch an der Lokomotive fest. Um jeden Platz wurde gekämpft. Ausgebesserten Gleisanlagen, notdürftig hergerichtete Behelfsbrücken und zum großen Teil nur einspurige Strecken, ließen den Zug nur langsam vorankommen. Auf den größeren Bahnhöfen immer wieder lange Wartezeiten, die ich immer benutzte, um etwas Essbares aufzutreiben. Hier sah ich aber auch, was unser Krieg in der Heimat angerichtet hatte. Wenn ich hier von Bahnhöfen schreibe, so waren diese nichts anderes, als schnell zusammengezimmerte Holzbaracken, umgeben von unüberschaubaren Ruinen. Auch entlang der gefahrenen Strecke, meist direkt am Bahndamm, unübersehbare Kriegsspuren.
Zerschossene Panzer, zerstörte Geschütze und die stählernen Gerippe ausgebrannter Fahrzeuge. Ich war erleichtert, als ich nach einigen Tagen am frühen Morgen Fürth erreichte.
Noch heute weiß ich nicht, wie ich zu Fuß über die Landstraßen bis nach Gebersdorf kam. Dort erhielt ich von einer uns bekannten Familie ein Fahrrad, das mir den restlichen Heimweg leichter machte.
Als ich den Windmühl Berg erreichte und auf Ansbach hinab sah, spürte ich, wie mir das Herz weit wurde. Ich hätte jubeln können vor Freude. Ich war wieder daheim. Alle Müdigkeit war verschwunden, als ich durch die Stadt zur Dombach Siedlung fuhr.
Es war nun doch später Nachmittag geworden. Im Hof spielten meine kleineren Geschwister, die mich wie einen Fremden betrachteten. Ich ging ins Haus. Das Wiedersehen mit meinen Eltern, es kostete viele Tränen. Es wurde nicht viel gefragt. „Hans, Gott sei Dank, Du bist wieder da". Mittlerweile hatte sich die gesamte Familie zusammen gefunden — bis auf Schwester Else und Bruder Karl. Die beiden kleinsten Geschwister Renate und Werner hatten sich bald an mich gewöhnt.
Nun erfuhr ich auch, wie sehr sich meine Eltern um mich gesorgt hatten. Mein Schulkamerad Nölp, den ich damals noch zum Verbandsplatz gebracht hatte, erfuhr noch im Lazarett, dass unser Panzer abgeschossen wurde. Nach seiner Rückkehr, noch vor Kriegsende, äußerte er meinen Eltern gegenüber seine Befürchtungen, dass ich mit meinen Kameraden gefallen wäre. Meine Eltern hatten trotzdem die Hoffnung und den festen Glauben an meine Heimkehr nicht aufgegeben.
Der Hans Oppel ist wieder daheim! Diese Nachricht verbreitete sich in Windeseile in der Siedlung und stärkte die Hoffnung vieler Frauen, die auf ein Lebenszeichen oder auch auf die Heimkehr ihrer vermissten Männer und Söhne warteten. Viele oft vergebens.
Die ersten Tage waren für mich eine ungemeine Lebensumstellung. Ich musste mich erst wieder eingewöhnen. Das Erlebnis Krieg, anderen wird es genau so ergangen sein, hielt mich noch lange gefangen. Der nächtliche Sternenhimmel, nun wieder über Ansbach, erinnerte mich immer wieder und sehr oft auch heute noch an diese schreckliche Zeit.
Allmählich kam auch die grausame Wirklichkeit dieses schrecklichen Regimes an die Öffentlichkeit, das wir damals so sehr verehrt hatten. Ich konnte und wollte vieles davon nicht glauben.
Aber auch daheim war der Krieg nicht spurlos vorübergegangen. Viele Ansbacher verließen nach den schweren Bombenangriffen die Stadt und zogen hinaus aufs Land.
Konnte Vater zu dieser Zeit, aus Angst vor Tieffliegern, diese Menschen nur nachts transportieren, so war er nun pausenlos im Einsatz, diese Menschen wieder zurück zu holen. Bruder Josef war zu dieser Zeit, neben Vater, die größte Stütze der Familie. Früh Morgens hieß es aufstehen und Pferde versorgen. Dann das bekannte Bild im damaligen Ansbach. Ein Junge mit Pferdegespann auf einem gummibereiften Kastenwagen der die Heil- und Pflegeanstalt mit Milch, Brot und anderen Waren versorgte, bevor er zur Schule ging. Bei jedem Wetter, Winter wie Sommer war er unterwegs. Nach der Schule weitere Fuhren, auch in die nähere Umgebung, wo auch er öfter die Bekanntschaft mit Tieffliegern machte. Dann hieß es immer runter vom Wagen und in die nächste Deckung, und immer die Angst um seine Pferde. Glücklicherweise überstand er und auch seine Pferde diese Angriffe unbeschadet. Josef war damals 12 Jahre alt.
Die führende und tatkräftige Person der Familie war damals und auch später die Mutter. Ihre Leistung war oft übermenschlich. Zehn Kinder auf die Welt zu bringen, aufzuziehen und dies in einer furchtbaren Notzeit, ist heute kaum noch nachzuvollziehen. Heute würde eine solche Frau als asozial angesehen. Damals erhielt sie als Anerkennung das Mutterschaftskreuz in Gold. Mögen die Ansichten über diese Auszeichnungen auch auseinander gehen, zumindest hatte man damals der Aufopferungen der Mütter gedacht.
Wie oft war sie bei Krankheiten tage- und nächtelang an unseren Betten gesessen. Helfende und heilende Medizin wie heute gab es kaum. Mit ihren Kenntnissen der Naturheilkunde brachte sie uns immer wieder auf die Füße. Ich selbst war in dieser Hinsicht ihr größtes Sorgenkind. Einige Male erhielt ich die letzte Ölung, die Sterbesakramente.
Mit dem Größer werden der Schwestern wurde es für Mutter etwas leichter, nahmen sie ihr doch viel Arbeit im Haushalt und in der Erziehung der jüngeren Geschwister, aber auch im Garten und in der Haltung des Kleinviehs ab. Um die Familie durch die Notzeit zu bringen, war der große Garten voll von Gemüse- und Kartoffel Beeten. Jeder kleinste Platz wurde genutzt. Gänse, Hühner und Kaninchen wurden gehalten, auch ein Schwein und zeitweise eine Milchkuh. In der NS-Zeit wurden diese Tiere alle registriert und wurden zum Volkseigentum. Hatte man zuviel davon, mussten sie abgeliefert werden, wie auch jährlich 70 Eier eines Legehuhns.
Bei Kontrollen, die schnell bekannt wurden, versuchte man schnell einige Tiere zu verstecken, um die registrierte Zahl niedrig zu halten, was natürlich immer mit großer Angst verbunden war.
Im Herbst wurde Kraut gehobelt, sobald ein Krauthobel auszuleihen war. Einem von uns wurden die Füße gründlich gewaschen. Er hatte unter Zugabe von viel Salz das gehobelte Kraut im Fass einzutreten, das in den Wintermonaten mit den Kartoffeln unsere Hauptnahrung war.
Wenn auch Mutter durch die großen Schwestern im Haus, Hof und Garten entlastet wurde, wurde ihre Arbeit nicht weniger. Sie half Vater bei Reparaturarbeiten, flickte Reifen, was zu dieser Zeit sehr oft vorkam und fuhr auch mit dem Pferdegespann. Überall wo Not am Mann war sprang sie ein.
Mit mir kam nun eine weitere Hilfe. Bald war ich wieder im Geschäft integriert und half mit, wo zu helfen war. Meine Bewerbung zur Wiedereinstellung zur Post war abgelehnt worden. Die anfängliche, hauptsächliche Arbeit lief im Wald ab, aus dem wir die Menschen mit Brennholz versorgten.
Mitte September kam ein Brief von Karl aus Saarbrücken, der dort in französischer Gefangenschaft mit seinen Kameraden die Trümmer der Bombenruinen beseitigen musste. In mir wuchs der Gedanke, Karl von dort nach Hause zu holen. Dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los und so schlich ich mich einige Tage später noch in der Nacht von daheim heimlich davon. Auf einem Zettel, den ich auf den Küchentisch legte, teilte ich meinen Eltern mein Vorhaben mit.
Bis Würzburg lief ich meistens zu Fuß. Von dort ging es dann im überfüllten Zug weiter nach Frankfurt und nach Wiesbaden. Immer wieder musste ich mich durchfragen und zwischendurch was zum Essen organisieren.
Bei Zweibrücken erreichte ich die französische Besatzungszone. Da ich hörte, dass dort streng kontrolliert würde, verließ ich vorher den Zug und erreichte zu Fuß anstandslos die Stadt und suchte nach einer Weiterfahrt. Endlich erreichte ich Saarbrücken, das zum größten Teil in Schutt und Asche lag.
Nun machte ich mich auf die Suche nach Karl. Immer wieder sah ich bewachte Trupps deutscher Kriegsgefangener, die in den Trümmern arbeiteten. Trotz der vielen Nachfragen kannte keiner meinen Bruder, bis ich dann den Tipp bekam, dass in einem anderem Stadtteil Gefangene aus Norwegen eingesetzt wären.
Hoffnungsvoll machte ich mich dorthin auf den Weg. Ja, sie kannten meinen Bruder, aber er hätte sich einige Tage vorher freiwillig nach Frankreich gemeldet.
Ich nahm damals nur nebenbei zur Kenntnis, dass mir da ausgemergelte Gestalten gegenüberstanden. Hungrig und müde und in den Augen die Sehnsucht nach zu Hause. Niedergeschlagen und unverrichteter Dinge kam ich wieder daheim an. Meine Eltern hatten an einen Erfolg sowieso nicht geglaubt. Ich hatte mich wieder einmal, ohne daran zu denken, in ein fragwürdiges Abenteuer gestürzt.
Erst später erfuhr ich von den damalig noch bestehenden Gefangenenlagern in Deutschland, wo junge Menschen noch zu Tausenden starben und so konnte ich Bruder Karl besser verstehen.
Seine damalige Lage in Saarbrücken, kleine Essensrationen, viele schwere Arbeit und mit seinen 20 Jahren ständiger Hunger. Als man denen, die sich freiwillig zum Arbeitseinsatz nach Frankreich meldeten gutes und reichliches Essen versprach, war Karl einer der ersten, die sich meldeten. Schlicht gesagt, der Hunger trieb ihn dazu. Karl landete in der Normandie bei einem Minenräumkommando. Zuerst suchten sie nur mit Eisenstäben ausgerüstet nach den zahlreichen Minen, die die Deutschen vergraben hatten. Immer wieder ging eine davon hoch und verletzte oder tötete einen seiner Kameraden. Viele deutsche Kriegsgefangene fanden bei diesen Kommandos damals den Tod oder kehrten als Krüppel zurück. Später wurden sie mit Minensuchgeräten der einfachsten Form versehen. Jeden Abend wurden die ausgegrabenen Minen in einer Grube gesprengt.
Nach einem Jahr kam Karl als Knecht zu einer Bauernfamilie. Anfangs herrschten noch strenge Auflagen, bald aber wurden sie lockerer. Zwischen Karl und der Bauernfamilie bildete sich eine Freundschaft, die sich später durch gegenseitige Besuche noch mehr festigte und bis zu seinem Tode im November 2001 anhielt.
Daheim knüpften wir wieder daran an, was Vater vor dem Krieg gemacht hatte. Wir fuhren mit unseren Pferdegespannen wieder Langholz. Es war eine schwere Arbeit. Alle Stämme mussten aus dem Wald herausgeschleift werden und wenn auch mit Hilfsmitteln, so doch mit unserer Körperkraft aufgeladen werden. Hände und Schultern waren zerschunden, denn oftmals trugen wir auch lange Stämme auf unseren Schultern aus dem Wald zum Wagen.
Auf den schlechten Wald- und Fahrwegen mussten wir unserem Gespann alles abverlangen.
Mit dem Geld, das wir damals verdienten, war nicht viel anzufangen, es hatte keinen Wert. Doch Vater wusste sich auch hier zu helfen. Er arbeitete wenn es ging für Naturalien, die er dann für das Nötigste anderswo wieder eintauschte. Das Tauschgeschäft blühte zu dieser Zeit. Bei uns begann sich nun ein leichter Aufwärtstrend abzuzeichnen.
Ein großes Hemmnis der wirtschaftlichen Lage war damals vor allem das schlechte Transportwesen. Züge fuhren nur wenige, also musste man sich mehr auf den Straßentransport verlegen. Alles was Räder hatte wurde nun dazu herangezogen.
Etwa ein Jahr nach dem Krieg wurden die Wehrmachts-Lkw, die auch noch teilweise in den Wäldern herumstanden, zusammengezogen, instand gesetzt und der „Motorpool" gegründet. Dies war eine staatliche Institution, die Fahrzeuge für dringende Transporte zur Verfügung stellte.
Vater bekam zu dieser Zeit einen 4,0 to Citroen aus diesem Bestand zugeteilt. Es wurde mein Fahrzeug, zumindest fuhr ich diesen, unseren ersten Lkw. Alles was anfiel, und es fiel immer mehr an, wurde damit gefahren.
Karl kam im Frühherbst 1947 aus der Gefangenschaft heim und betätigte sich beim Holztransport. Während Josef und jetzt auch Adolf daneben noch immer mit Pferdegespannen die gewohnten Transporte durchführte.
Nach der Währung mussten wir den Citroen Beute Lkw auf Anordnung der französischen Regierung abgeben. Ein schwerer Schlag für uns und besonders für mich, da ich diesen Lkw gefahren hatte. Wir waren nun wieder ohne Lkw, obwohl das Fuhrgeschäft nun anfing, zu florieren.
Unser gesamtes Kapital reichte gerade für einen 3,6 to. Allrad Opel-Blitz, den Vater vom Gemüse-Förster kaufte und von Karl gefahren wurde. Wir rüsteten dieses Fahrzeug nun zusätzlich mit einem Planengestell und Plane aus und konnten somit alle anfallenden Transporte, wie Umzüge, Bier, Brenn- und Schnittholz und später auch Grubenholz durchführen.
Obwohl weitere Investitionen nötig gewesen wären, reichte das Geld nicht dazu, zumal die kleineren Geschwister größer wurden und sich damit auch die Kosten für die Familie steigerten.
Damals hörte man „ach die vielen Kinder", später „mit den vielen Kindern war es leicht ein Geschäft aufzubauen". Ich habe es anders erlebt.
Ich hatte nun keinen Lkw mehr und die Geldsorgen meines Vaters drückten auch mich und so bewarb ich mich bei den US-Streitkräften in Katterbach als Fahrer. Zu diesem Entschluss trieb mich mein Ehrgeiz. Ich wollte mit diesem Verdienst die Familie unterstützen, aber vor allem den Kauf eines neuen Lkw,s ermöglichen.
Meine Bewerbung hatte Erfolg. Ich wurde eingestellt und betrat damit, für mich, eine neue Welt der Fernfahrer.
Zu dieser Zeit waren die US-Streitkräfte der größte Arbeitgeber der Region. Das Depot auf dem ehemaligen deutschen Flugplatz wurde immer mehr ausgebaut. Waren aller Art, die in Bremerhaven aus den großen Versorgungsschiffen gelöscht wurden, kamen hier in Güterzügen an, wurden entladen, gestapelt, sortiert und mit unseren Lkw,s an alle militärische Standorte geliefert.
Ebenfalls bestand eine Linienverbindung zwischen Katterbach — Frankfurt, Wiesbaden und Gießen, wo es ebenfalls solche Depots gab. Ich war bisher nur den 4,0 to. Lastwagen gewohnt. Diese Sattelzüge hatten andere Dimensionen. Nach ein paar Tagen Einweisung hatte ich meinen eigenen Lkw. Wir saßen allein auf einem Sattelzug und fuhren auf unseren Touren meistens im Konvoi, zumindest aber möglichst mit zwei Fahrzeugen, um uns bei auftretenden Pannen gegenseitig zu helfen.
Im Vergleich zu den deutschen Fernfahrern, die Speditionen nahmen zu dieser Zeit, auch wenn noch im kleinen Ausmaß, ihre Transporte wieder auf, waren wir besser gestellt. Wir saßen in modernen Sattelzügen mit Hilfslenkung und Otto-Motoren bis zu 180 PS. Unsere Auflieger hatten ca. 16 to. Nutzlast mit einer Gesamtlänge von 14 m. Die deutschen Kollegen fuhren noch Fahrzeuge aus alten Wehrmachtsbeständen mit langen Motorschnauzen, ohne Hilfslenkung und PS-schwachen Diesel-Glühkerzenmotoren, die im Winter mit der Kurbel angedreht werden mussten. Eines aber hatten wir mit diesen Kollegen gemeinsam. Es waren die äußerst schlechten Straßen. Die Bombentrichter auf ihnen waren nur notdürftig ausgebessert, die Brücken die in den letzten Kriegstagen noch gesprengt wurden, mussten in langsamer Fahrt über Behelfsbrücken umfahren werden. Von einem Asphaltbelag kaum eine Rede. Die tiefen Schlaglöcher wurden von den Straßenarbeitern mit Schubkarre, Schaufel und Besen ausgebessert.
Hatten unsere Sattelzüge nur eine Länge von 14 m, bestand für die deutschen Gespanne noch kein Längenlimit. Mit 145 PS-Maschinen zockelten sie mit zwei Anhängern über die Straßen, hängten an Steigungen davon einen ab und kämpften sich in Schrittgeschwindigkeit über den Berg. Dort stellen sie diesen Hänger ab, fuhren zurück und holten den zweiten.
Hintereinander gekoppelt ging die Fahrt weiter bis zur nächsten Steigung, wo sich der Vorgang wiederholte. Das Be- und Entladen geschah meistens per Hand und so waren diese Gespanne, z.B. von Nürnberg nach Hamburg, oft zwei Wochen unterwegs. Wir hatten es aufgrund unserer Fahrzeuge und unserer Ladungen nicht so schwer wie diese Kollegen, aber auch für uns war es eine harte Zeit.
Eine Tour von Katterbach nach Wiesbaden mit einer Fahrzeit von 12 Stunden war eine Spitzenleistung. Es waren nicht nur die schlechten Straßenverhältnisse, die Zeit forderten, es waren auch die damaligen Straßenführungen überhaupt. Jede Stadt, jeder Ort musste durchfahren werden, Umgehungsstraßen gab es nicht. Behinderungen durch langsam fahrende landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Kuhgespannen, hinter denen man endlos lange nachfahren musste, bis es eine Gelegenheit zum Überholen gab, waren gang und gebe. Und dann die Bahnübergänge, die lange Wartezeiten verursachten. Die Straßen waren damals teilweise so eng, dass bei einer LKW-Begegnung einer stehen bleiben musste. Bei Nachtfahrten waren bei dem schwachen Scheinwerferlicht die Straßenränder kaum zu erkennen. Reflektierende Mittelstreifen und Strassenpfosten gab es nicht. Äußerst anstrengend waren Fahrten bei Nebel.
Schlafkabinen oder Standheizungen waren nur ein Wunschtraum. In Decken eingewickelt, quer über die Sitze liegend, oder hinter dem Lenkrad sitzend, wachte man schlotternd vor Kälte bald wieder auf. Bei Schnee waren die Berge nur mit Schneeketten zu bewältigen. Streusalz wurde erst viele Jahre später eingesetzt. Im Abstand von ca. 50 m standen Streukästen, die im Herbst mit Sand und Splitt gefüllt wurden. Mit der Schaufel, die zum unentbehrlichen Arbeitsgerät wurde, streute man von Streukasten aus 25 m vor und vom nächsten 25 m zurück, dann holte man das Fahrzeug nach und das Streuen wiederholte sich. Bei starken Schneefällen war es noch schlimmer. Die V-förmigen Schneepflüge drückten den Schnee von der Straße nur nach außen, wodurch die Fahrbahnen immer enger wurden. Wegen der Unebenheiten waren sie so hoch eingestellt, dass immer eine Schneehöhe von über 10 cm auf der Straße liegen blieb und festgefahren immer höher wurde.
Auf dieser Schneedecke bildeten sich durch Schmelzwasser tiefe Löcher und Furchen. Dadurch kam es immer wieder vor, dass zwei sich begegnende Lkw,s seitwärts aufeinander rutschten und sich ineinander verkeilten. Stundenlange Wartezeit, dergleichen auch bei anderen Unfällen, war die Folge. Nächtliche Pausen unterwegs hatten wir tunlichst zu vermeiden, da immer wieder Straßenräuber mit Schläuchen Benzin abzapften und sich an der Ladung vergingen.
Trotz dieser damaligen Umstände machte mir das Fahren Spaß. Ich war nichts anderes gewohnt und konnte mich an alles in dieser Zeit anpassen. Mit meinen 21 Jahren und meiner schmächtigen Figur war ich bald überall bekannt und auch beliebt, wie ich immer wieder feststellen konnte. Auf den deutschen Fernzügen saßen damals fast ausschließlich gewichtige Fahrer, auf die noch heute der bekannte Begriff „Brummi" zurückgeht. Später als die Ladehilfsmittel mehr wurden und die Körperkraft nicht mehr so sehr gefragt war, saßen immer öfters schlanke Menschen am Steuer, wie die heutigen Fernfahrer.
So war meine damalige erste Fernfahrerzeit, mit der mich noch viele Erinnerungen verbinden.
An ein Ereignis denke ich noch oft zurück. Ich war an einem Sonntagabend im Winter von Katterbach weggefahren und hatte am nächsten Vormittag das Depot in Frankfurt erreicht. Dort wurde nach der Entladung mein Sattel nach Gießen beladen. Eine Zwischentour dachte ich damals. Aber es kam anders. Mein neuer Fahrauftrag lautete Bremerhaven.
Wie bereits erwähnt, die Autobahnen waren nicht zu befahren und so kämpfte ich mich über die Landstraßen über Kassel, Paderborn und Osnabrück hinauf zur Hafenstadt. Die Norddeutschen hatten besondere, mit Ziegelsteinen gepflasterte Straßen. Sie waren stark gewölbt, und durch die hereinragenden Baumäste bei Gegenverkehr stets ein Problem.
Unterwegs wenig Schlaf, kam ich am nächsten Tag, spätnachmittags, in Bremerhaven an. Ent- und Beladen und wieder zurück nach Frankfurt. In der Nacht gönnte ich mir eine längere Schlafpause, trotzdem traf ich im Frankfurter Depot am Donnerstag sehr früh ein. Nun erhielt ich dort den Fahrauftrag, leer nach St. Georgen im Schwarzwald zu fahren und dort die von den Amerikanern so heiß begehrten Schwarzwälder Tisch- und Wanduhren zu laden. Ich war bis dahin noch nie im Schwarzwald gewesen. Anhand einer Landkarte suchte ich mir die Fahrtroute heraus. Nun dachte ich, soweit ist das gar nicht und freute mich auf diese Schwarzwaldfahrt.
Über Mannheim, Bruchsal und Karlsruhe bis Offenburg, alles ebene Straßen, gab es keinen Schnee. Den gab es dann ab dem Kinzigtal bis hinauf nach Hausach.
In Hausach hieß es Schneeketten aufziehen. Im Gutachtal aufwärts erlebte ich den bekannten Schwarzwaldwinter und vor St. Georgen, es war schon längst Nacht, an einer kurvenreichen Steige hatte ich selbst mit Schneeketten noch Schwierigkeiten. Nach Mitternacht hatte ich dann St. Georgen todmüde erreicht.
Am nächsten Morgen, es war Freitag, ging es wieder zurück. Nun ging es leichter, wie immer zum Wochenende, aber es ging auch meist abwärts. Hinter Hausach konnte ich die Schneeketten wieder abmontieren. Müde erreichte ich am Samstagvormittag das Depot in Katterbach und da stand er vor mir, unser Fuhrparkleiter, ein Amerikaner, groß und breit, der Mister Mc Leone. Mit seiner tiefen Stimme stellte er mich zur Rede. „Oppel" dieses Wort rollte ihm immer über die Zunge wobei er die „pp" so richtig betonte. „Oppel, where do you come from, your much sleeping, staying last week?" „Mister Mc Leone", versuchte ich ihm zu erklären „i was big trip" und erzählte ihn von meiner Wochentour.
Katterbach — Frankfurt — Gießen — Bremerhaven Frankfurt und St. Georgen. „St. Georgen, what‘s that?" „Im Schwarzwald", ich versuchte es ihm zu erkären, doch er konnte damit nichts anfangen. Da fiel mir die nahe Schweiz ein und sagte „Switzerland". Das war für ihn ein Begriff.
Vielleicht kannte er das St. Georgen in der Schweiz. „Oh yes" meinte er — und dann wie ein Lob: „grand big tour, Oppel"
Als später Mc Leone versetzt wurde und ein Amerikaner, der bisher auch als Fahrer eingesetzt war, seine Position erhielt, bekam ich dessen aufgemotzten Sattelzug, um den mich viele Kollegen beneideten.
Meinem Verdienst, den ich zum größten Teil abgab, hatte meine Mutter separat gespart.
Mit diesem Geld konnten wir uns 1950 unseren ersten neuen Lkw kaufen, es war ein 1,5 to. Opel. Ich weiß noch, wie wir uns alle freuten, als dieser Lkw auf dem Hof stand. Für Vater dürfte es die größte Freude gewesen sein, der aber damals schon zu kränkeln begann.
In meiner Freizeit hatte ich daheim immer mitgeholfen. Als die Krankheit meines Vaters immer schlimmer wurde, gab ich mein Fernfahrerleben bei den US-Streitkräften auf und war daheim wieder voll beschäftigt.
Das war Ende 1951 und auch der Zeitpunkt, wo Vater den zweiten neuen Lkw, einen 4,0 to. Borgward mit 85 PS bestellte.
Er hatte die Erfüllung seines Traumes vor Augen. Mit drei Lkw im Einsatz war es der endgültige Start in ein größeres Fuhrunternehmen. Die Pferdegespanne hatte Vater inzwischen abgebaut. Der Opel-Blitz, von Josef gefahren, war voll im erträglichen Einsatz. Vater hatte frühzeitig schon weit voraus gedacht. Er brauchte einen Kfz-Mechaniker im Betrieb und schickte daher Bruder Adolf nach seinem Schulabgang im Jahre 1949 zu Opel-Franken in die Lehre. Schon jetzt machte sich dieser Entschluss bezahlt. Adolf konnte daheim Reparaturen ausführen, die uns bisher in den Werkstätten viel Geld kosteten.
Doch mit Vater ging es gesundheitlich abwärts. Als er endlich zum Arzt ging und man bei ihm Tbc feststellte, war es schon zu spät. Ohne auf die Anweisung des Arztes zu achten, schuftete er weiter, obwohl ihm das Atmen immer schwerer fiel.
Mit diesem Verhalten und seiner Lebenseinstellung überhaupt, wurde er ein Vorbild für uns Brüder, dass uns das ganze Leben hindurch begleitete. Nicht aufgeben. Es gibt nichts, was nicht zu schaffen wäre und sollte es noch so schwer sein. Bei nassen, kalten Wetter holte er sich bei einer Langholztour zu seiner Krankheit noch eine Lungenentzündung, die ihn auf das Krankenbett warf, aus dem er nicht mehr kam. Seine immer wiederkehrenden Blutstürze zeigten, dass es zu Ende ging. Obwohl er immer gehofft hatte, noch den neuen Lkw zu sehen, der am 14. März in Bremen abgeholt werden sollte, verstarb er friedlich am 11. März 1952.
Sein Tod war für uns ein schwerer Schlag. Er war immer die führende und auch treibende Kraft gewesen. Wie sollte es weitergehen? Wir Brüder waren alle, zumindest unserer damaligen Ansicht nach, noch zu jung, um den Betrieb weiter zu führen.
Es war die Mutter, die nun alles in die Hand nahm und mit ihrer enormen Willenskraft den Betrieb weiterführte. Es war für sie wieder eine schwere Zeit und oft hatte sie nur noch einen einzigen Halt, ihren Herrgott, der ihr in ihren Gebeten wie so oft neue Kraft gab.
Bruder Josef hatte einen Tag nach Vaters Tod den neuen Borgward in Bremen abgeholt. Mit ihm besaßen wir nun drei Fahrzeuge. Den 1,5 to Opel-Blitz, den 1,5 to. Opel-Blitz Allrad und den neuen 4,0 to. Borgward, den wir ebenfalls umbauten um alle Güterwaren transportieren zu können.
Dazu kauften wir einen gebrauchten Anhänger, so hatten wir erstmals einen sogenannten "Zug" — Motorwagen mit Anhänger. Damit fuhren wir Coca-Cola von Nürnberg nach Ansbach. Ebenso führten wir damit auch Umzüge durch und transportierten Schnitt- und Langholz und vor allem Grubenholz, das im rheinländischen Bergbau immer mehr benötigt wurde. Dieses Grubenholz hatte eine bestimmte Stärke, aber verschiedene Längen. Auf unseren Schultern trugen wir die Stämme aus dem Wald und beluden unsere Fahrzeuge. An verschiedenen Bahnhöfen wurde abgeladen. Die weitere Behandlung gab vielen Menschen Arbeit.
Mit der Baum- oder Handsäge wurden die Stämme genau auf die vorgeschriebene Länge abgeschnitten und mit langstieligen Schabeisen entrindet, bevor sie zum Transport auf Güterwagen verladen wurden. Viele werden sich an die schwere und schlecht bezahlte Arbeit erinnern. Es war eine Schufterei für alle Beteiligten.
Diese Arbeiten und unsere Grubenholztransporte zogen sich über viele Jahre hin. Bei anderen Transporten mussten unserer Fahrzeuge immer wieder passend umgebaut werden. Mit einem 4,0 to Nachläufer, den wir erstanden und den Borgward mit einem Drehschemel versahen, weiteten sich die Holztransporte aus.
Bisher hatten wir zu unserem Opel-Blitz für diese Transporte nur einen einachsigen GMC-Hänger. Nun wurden die Holzfahrten leichter und auch schneller. Bruder Karl wurde zum Langholzfahrer. Mehr Ladung brachte mehr Geld, also wurde zu dieser Zeit aufgeladen, was nur ging. Die Vorschriften waren damals noch nicht so streng und große Waagen gab es kaum. Das Gewicht der Stämme konnte man nur schätzen.
Der Nachläufer musste noch gelenkt werden. So saß damals der Beifahrer auf einem Sitz hinter der Achse und kurbelte aus Leibeskräften die lange Ausladung durch die engen Kurven. Die gute Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Kurbler war enorm wichtig. Damals ein bekanntes Straßenbild.
Im Wald waren die Fahrten noch schwieriger. Man muss nur an die damaligen Waldwege zurückdenken. Sie waren nichts anderes als tieffurchige Fuhrwege.
Im Winter bei Frost waren sie noch einigermaßen befahrbar. Im Frühjahr und im Sommer und nach starken Regenfällen waren sie grundlos. In den tiefen Spuren stand das Wasser oft den ganzen Sommer. Mit dem schwerbeladenen Fahrzeug über diese Wege aus dem Wald heraus zu kommen, erforderte das ganze Können des Fahrers.
Trotzdem kam es immer wieder vor, dass der Lkw im Schlamm stecken blieb oder der Nachläufer in den Graben kippte. Abladen um das Fahrzeug wieder frei zu bekommen und wieder aufladen, nur mit einer Handseilwinde, diese Vorkommnisse vergisst man nicht. Mein Bruder Karl und auch Josef, die Holzfahrer, mussten dies bei ihren Langholzfahrten öfters erleben. Gebrochene Aufbauteile, Federbrüche und abgerissene Steckachsen waren keine Seltenheit. Bruder Adolf bekam abends noch viel zu tun.
Weitere Investitionen wurden nötig, die aber mit unseren Einnahmen nicht zu bewältigen waren. Das Kapital fehlte, von den Banken wurde uns, wie bereits bei Vater, kein großer Kredit eingeräumt oder sie bestanden auf Bürgschaften, die aber schlecht aufzutreiben waren. Frau Rummel, Textilgeschäft in der Uzstraße, war die Einzige, die auf Anfrage der Mutter diesbezüglich für uns eintrat und uns damals aus einer großen Notlage half. Ich habe es bis heute nicht vergessen. Später war es der Direktor der Sparkasse, Herr Engelhard, der auf unsere Arbeit vertraute und uns leichter mit Krediten versorgte, die wir zum stetigen weiteren Aufbau dringend brauchten. Dieses Entgegenkommen machte es uns in all den folgenden Jahren leichter.
Ich fuhr mit dem Opel Blitz noch immer hauptsächlich Umzüge. Es gab immer noch ein Hin und Her im Land. Zwar waren die meisten Städter, die dem Bombenhagel aufs Land entflohen waren, wieder zurückgekehrt, dafür waren aber die Flüchtlinge aus den Ostgebieten gekommen, die nun aus den engen Wohnverhältnissen heraus in neue Wohnungen zogen, oftmals auch in ihr neu gebautes Haus.
In den wenigen Jahren seit Kriegsende hatte sich viel verändert, wie ich, der andauernd durchs Land fuhr, immer wieder feststellen konnte. Die Häuser, die mit Flüchtlingen vollgestopft worden waren, wurden wieder leerer. Die Bauwirtschaft war wieder angelaufen und schaffte Wohnungen. Der Lebensstandard war gestiegen, es gab alles zu kaufen, wenn man Geld hatte. Manche hatten es damals schon. Wir mussten noch sparen, wie so viele Menschen in dieser Zeit.
Auch die Zeit der „Hamsterer" war vorbei. Viele Menschen waren bis dahin aus der Stadt übers Land gezogen, um bei den Bauern Wertgegenstände gegen etwas Essbares einzutauschen.
Was wurde da alles getauscht. Goldschmuck, Silbergeschirr, Gemälde, die Stiefel der gefallenen Männer oder Söhne, die letzten Stücke der Bettwäsche und sogar Klaviere gegen Eier, Fleisch, Butter oder Mehl.
Damals kursierte unter den Städtern der zynisch-böse Witz von den Bauern, die ihre "Kuhställe mit Perserteppichen auslegen, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit den Wertgegenständen, die man ihnen ins Haus trägt".
Es war eine Zeit, über die man heute kaum noch spricht. Unter der Wohnungsenge hatten wir, unsere Familie, auch ohne Einquartierung zu leiden. Unser Haus in der Dombachsiedlung war klein. Die Küche mit 16 qm Fläche war Kochraum, Wohnzimmer und Büro zugleich. Dazu stand in der Ecke noch ein Sofa, auf dem sich Vater während seiner Krankheit oft ausruhte.
Da war aber auch noch die Zeit, die uns Kriegsteilnehmer sehr deprimierte. Wir konnten die Welt nicht mehr verstehen. Unsere Idole wie „der Führer", entpuppten sich als die größten Verbrecher und Menschenverächter. „Seine Soldaten" im Krieg mit Tapferkeitsauszeichnungen teils hoch dekoriert, wurden in den letzten Kriegstagen noch von ihm und von Goeppels auf das Übelste als Feiglinge und Versager beschimpft.
Von den vielen Millionen Menschen, für deren Tod sie verantwortlich waren — kein Wort.
Wir waren die Verlierer, die Amerikaner die Sieger und jetzt auch die Helden, zumal sie alles hatten, und vor allem die Dollars. Schnell wussten das Gastwirtschaften zu nutzen und richteten sich danach aus.
Deutsche Musikanten traten als Jazz-Bands auf, und da viele junge deutsche Männer im Krieg geblieben waren, also Männermangel herrschte, blieben auch die deutschen Mädchen nicht aus. Neben Liebeleien entstanden aber auch feste Bindungen, die sich bis heute gehalten haben, wie bei meiner Schwester Anni und Luise, die mit ihren Männern nach Amerika gingen.
 |
Lili Marlen
|